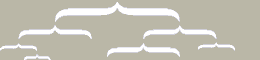
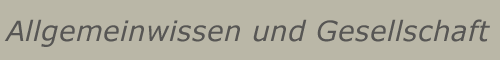
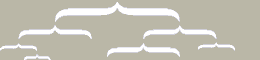 |
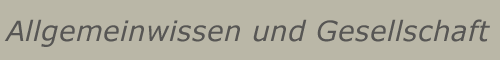 |
Objekte der Visualisierung |
Was wird im Einzelfall visualisiert?Generelles Das Wort "was" ist terminologisch zu präzisieren. Es stehen verschiedene Termini zur Auswahl. Das Wort ›Gegenstand‹ wäre verfänglich, weil es nahelegt, dass es sich beim Visualiierten um ein greifbares Ding handelt. ›Thema‹ bedeutet in der Philosophie seit dem Spätmittelalter die materia, quaestio, den Denkinhalt, das worüber nachgedacht wird. Heutzutage ist das Wort semantisch zu weit. ›Sujet‹ wird für den noch ungeformten Stoff in Dichtung und bildender Kunst verwendet. Hier wird der Begriff ›Objekt‹ (O) verwendet – und zwar im Sinne der Semiotik: gemeint sind damit nicht nur einzelne ›Dinge‹ in der Welt, sondern auch mentale Schemata / Konzepte, Ereignisse, Prozesse, Gesetzmäßigkeiten, mathematische Relationen (im Sinne von elementweisen Zuordnungen von Mengen), Aussagen, deontische Sätze u.a.m. auf die sich unsere Erkenntnis richtet. Dies im Sinne von Charles Sanders Peirce (1839–1914): “By an object, I mean anything that we can think, i.e. anything we can talk about.” > http://www.commens.org/dictionary/term/object Der Begriff ›Objekt‹ soll nicht im Sinne einer Objektivität im alltäglichen Sinn missverstanden werden. Dass mit wenigen Ausnahmen alle semantisch (in einer bestimmten Sprache!) umschriebenen ›Objekte‹ gesellschaftliche Konstrukte sind, ist selbstverständlich. Damit wir unhinterfragt handeln können, sind sie eingeübt, institutionalisiert, und werden so als "Wirklichkeit" wahrgenommen. Unsere ›Objekte‹ beruhen auf solchen sozialen Konstrukten, die erkenntnistheoretisch nicht analysiert werden. Vgl. dazu Peter L. Berger / Thomas Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie, engl. 1966, dt. Frankfurt: S.Fischer 1970. (Mit einer an die Ontologie angelehnten Definition von ›Objekt‹ gerät man in des Teufels Küche, vgl. die einschlägigen Artikel in philosophischen Wörterbüchern, z.Bsp.: http://www.zeno.org/Eisler-1904/A/Object.) Jeder Objekttyp erfordert zur Visualisierung ein eigenes Transformationsprozedere; das wird jeweils mit Links zu den speziellen Kapiteln angegeben. + Vgl. ferner das Kapitel über die Unterschiede der Medien Bild/Sprache |
|||||||||||||||||
InhaltsübersichtO Unikat O Stabiler Typus O Hypothetischer Idealtyp O Abstrakte Vorstellung O Mentales Konstrukt O Gedankliche Ordnung O Funktionsbegriff O Logisches Verhältnis O Aussage mit Quantor O Aussagenverbindung, logischer Schluss O Zuordnung von Elementen aus verschiedenen Sphären O Bauplan O Phasen eines zeitlichen Ablaufs O Beziehungen zwischen Einzelelmenten O Prozess-Ablauf, Wirkungsgefüge, Funktionszusammenhang O Mathematische Funktion O Quantitäten in Relationen O Intelligibilia O Psychologischer / moralischer Begriff O Deontischer Satz O Historisches Ereignis O Mythische Gestalt O Vision O Nicht bildlich Darstellbares O Unbekanntes O Fiktionales Narrativ O Imaginiertes (zu realisierendes) Gebilde O (Von einer Figur im Bild) Gesagtes / Gedachtes |
|||||||||||||||||
Objekt: UnikatAls "Eigennamen" werden Wörter bezeichnet, denen ein einziges reales Objekt (eine Person, eine Stadt, aber auch ein Dinge wie die Spiralgalaxis NGC 6872) zugrundeliegt. Auf dieses Objekt lässt sich mit ausgestrecktem Finger zeigen (lat. ostendo, daher "Ostensiv-Definition") und es ist durch ein mimetisches Bild repräsentierbar. Insofern als die meisten Objekte dreidimensional sind, unterliegt die Visualisierung der Perspektive des Bildgebers (Zeichners, Fotografen). Das macht aber für die in diesem Kapitel angezielte Logik der Objekttypen keinen Unterschied. ••• Beispiel: Der Mond. (Ein Fall, wo wir nur eine einzige Ansicht auf das Objekt haben.)
••• Beispiel: Individuell zugeschliffene Diamanten bekommen Namen: der Stern des Südens, Kohinoor usw.
••• Beispiel: Bauwerk Steinerne Bauten (insbes. Burgen, Tempel, Kirchen) sind (abgesehen von den Plattenbauten in der DDR!) einzigartig errichtet und so erkennbar. Allerdings sind sie gelegentlich Umbauten unterworfen, so dass ihre Abbildung mit einem Datum versehen werden muss.
••• Beispiel: Portrait einer Person (+ mehr dazu >>> hier) Die 596 Bildnisse der Schedelschen Weltchronik (1493) sind von nur 72 Holzstöcken gedruckt. Kaiser tragen Szepter, Krone, Reichsapfel; Päpste tragen die Tiara, Bischöfe die Mithra usw. Die Insignien oder die die Unterschriften der Kaiser und Könige charakterisieren die Person, nicht die Gesichtszüge. Man erkennt, dass ein individualistisches Menschenbild vorausgesetzt sein muss, damit ein Portrait im neuzeitlichen Sinne funktionieren kann. Das Aussehen einer Person ändert sich im Lauf des Lebens ständig. Das Bild zeigt zwar ein Unikat, aber es ist mit einer Datumsangabe zu versehen: P (t).
Dabei muss das Bild nicht in unserem modernen Sinn mimetisch genau sein. Wenn der Betrachter (oder die Totengottheit) weiß, wer abgebildet ist, kann das Portrait auch stilisiert sein:
••• Auch historische Ereignisse sind Unikate. (+ mehr dazu unten.) Im folgenden Bild geht es nicht darum zu zeigen, wie Archimedes physiognomisch ausgesehen hat, sondern es wird ein prägnanter Moment* in seinem Leben als "Momentaufnahme" gezeigt, da wo er zum ihn bedrohenden Soldaten sagt »Störe meine Keise nicht«. *) Zum Ausdruck »prägnanter Augenblick« vgl. Lessing, »Laokoon« [1766], ¶ XVI und XIX > http://www.zeno.org/nid/20005265576 und Schiller in seinem Brief an Goethe vom 15. September 1797.
••• Auch die Erdoberfläche ist ein Unikat, das in Landkarten visualisiert wird.
|
|||||||||||||||||
Objekt: Stabiler TypusHandelt es sich um relativ stabile, (soweit es das überhaupt gibt) interkulturell unveränderliche Entitäten wie zum Beispiel eine Tierart, Pflanzenart, Gesteine, usw. lässt sich ein typisches Bild generieren. Es handelt sich dabei nicht um eine mimetische Abbildung eines bestimmten Exemplars. Beispiel: Der Hummer, wie ihn Conrad Gessner zeigt:
Nicht nur typische äußere Gestalten, sondern auch typische Verhaltensweisen können Objekt sein. Beispiel: Beschwichtigungsverhalten des Wolfs
Hier wird die Variationsbreite eines Typus dargestellt:
+ Mehr zur Problematik des Typischen im Kapitel Typen |
|||||||||||||||||
Objekt: Hypothetischer IdealtypDas ist ein weites Feld. + Mehr zu dieser Problematik im Kapitel Typen Beispiel: Das basilika Schema im Kirchenbau
Beispiel: Das ideale Urbild des Wirbeltiers Der Typus ist vom Forscher aufgrund idealisierter Organe entworfen. Er hat die Funktion einer Erklärung der realen Vielfalt.
|
|||||||||||||||||
Objekt: Abstrakte VorstellungDass gewisse Bilder ›Abstraktes‹ konkretisieren, ist leicht gesagt. Es gibt verschiedene Sorten von Abstraktheit. Eine Klassifikation der Arten von Abstraktion kann hier nicht geleistet werden; wir begnügen uns mit einigen Hinweisen. • Bei der klassenbildende Superierung abstrahiert man, indem man von Merkmalen der Objekte absieht, d.h. die Schnittmenge bildet. Ein Beispiel ist: Weitsprung, Hochsprung, Stabhochsprung …, welche zum Abstraktum springen / Sprung abstrahierbar sind. Geht es darum zu zeigen, was ein "Sprung" ist, oder geht es darum zu zeigen was für verschiedene "Arten von Sprüngen" es gibt? Oder um beides? Es kommt auch auf die Textsorte an: In einem (semantik-orientierten) Wörterbuch ist die Funktion: das Abstraktum "Sprung" visualisieren in einem Sach-Lexikon ist die Funktion: zeigen, welche Arten von Sprüngen man ausführen kann.
• Die komplexbildenden Superierung ist die Zusammenfassung einer Menge von Begriffen unter einem neuen Oberbegriff, was auch als Vereinigungsmenge beschrieben werden kann. Beispiel ist das Sinfonieorchester, bestehend aus Geigen, Bratschen, Celli, Oboen, Flöten, Hörnern, Pauken usw. Hierhin gehören lebensweltliche Weltausschnitte wie z.B. der Badestrand, der hier mit einem all-umfassenden Kompositbild repräsentiert wird:
+ Vgl. dazu insbesondere das Kapitel zur Bildvielheit |
|||||||||||||||||
Objekt: Mentales KonstruktBeispiel: Der nördliche Sternhimmel Es ›gibt‹ die Sternbilder nicht, wir sehen sie in den chaotischen Haufen von Lichtpunkten des Nachthimmels hinein. Um den Blick anzuleiten, werden Sternkarten (mit Bootes, Pegasus, Schwan, großem Wagen usw.) gezeichnet. Diese Sternbilder werden auf den Himmel projiziert.
Beispiel: Die sieben Weltwunder – eine willkürliche Zusammenstellung, die auf einem antiken Reiseführer beruht.
|
|||||||||||||||||
Objekt: Gedankliche OrdnungOrdnung in eine Menge gedanklich in Zusammenhang stehender Begriffe kann erstellt werden …
Beispiel für (a) Faktoren, die die Mietpreisbildung beeinflussen
Beispiel für (a) Zusammenhänge zwischen Organismus und Umwelt
Beispiel für (b): Alles Seiende in einer Baumgraphik Zerlegung/Aufteilung des Seienden, durch die gezeigt wird, dass alle seienden Dinge in den 14 Bäumen (Unterabteilungen) enthalten sind:
+ mehr dazu im Kapitel zu den Baumgraphiken Literaturhinweis: Paul Michel, Verzweigungen, geschweifte Klammern, Dezimalstellen. Potenz und Grenzen des taxonomischen Ordnungssystems von Platon über Theodor Zwinger bis Melvil Dewey, in: Allgemeinwissen und Gesellschaft, hg. von Paul Michel / Madeleine Herren / Martin Rüesch, Aachen: Shaker Verlag 2007, S. 105–144. |
|||||||||||||||||
Objekt: FunktionsbegriffDer Begriff ist umstrittten. Gemeint sind hier Wörter, die nicht an sich etwas bedeuten ("Autosemantika"), sondern "autosemantische" Wörter in Relation setzen. Beispiel: Lokale Präpositionen
|
|||||||||||||||||
Objekt: Logisches VerhältnisBeispoiel: das Logische Quadrat (J. D. 2010) Das logische Quadrat dient der Veranschaulichung elementarer logischer Beziehungen von Aussagen mit jeweils demselben Subjekt und Prädikat. Der Ursprung dieser Aussagen findet sich in Aristoteles’ Werk De Interpretatione 6-7, welche im zweiten Jahrhundert n. Chr. von Apuleius von Madaura vervollständigt und graphisch in die quadrata formula, das logische Quadrat, umgesetzt wurden. Die bis heute gebräuchliche Terminologie der einzelnen Bestandteile geht auf Boethius und dessen Aristoteles-Kommentare zurück. Die 4 verschiedenen logischen Beziehungen (konträr – kontradiktorisch – subaltern – subkonträr usw.) zwischen den 4 verschiedenen Urteilstypen (allgemein bejahend – allgemein verneinend – partikulär bejahend – partikulär verneinend) werden seit der von Michael Psellos im 11. Jh. ersonnenen Graphik kompakt und einprägsam so visualisiert:
Die logischen Beziehungen der Aussagen lassen sich auch in einer Tabelle auflisten. Die von Apuleius ersonnene Graphik ist jedoch viel kompakter und einprägsamer, nicht nur weil sie sämtliche Relationen der einzelnen Aussagen gleichzeitig abbildet, sondern auch, da es zu keinerlei Überschneidungen innerhalb der quadratischen Anordnung kommt. Die Illustration dient allerdings in erster Linie als Gedankenstütze oder Merkhilfe, da die logischen Beziehungen nur im Text genau definiert und nicht aus der Graphik allein korrekt erfasst werden können. Dies betrifft insbesondere die Subalternität, welche als einzige der Relationen nicht wechselseitig, sondern lediglich unilateral funktioniert. Eine Variante dieses logischen Quadrats listet zusätzlich die Äquivalente der allgemeinen und partikulären Aussagen auf. Spezialliteratur Prantl, Carl von (1855), Geschichte der Logik im Abendlande (Leipzig: Hirzel). ›Quadrat, logisches‹ in: Historisches Wörterbuch der Philosophie; Band 7. P-Q (1989). Ritter, Joachim, Karlfried Gründer und Gottfried Gabriel (Hrsg.), (Basel: Schwabe), Sp. 1733-1736. Parsons, Terence (Fall 2008 Edition), "The Traditional Square of Opposition", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), URL = http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/square/
Beispiel: Wahrheitswerttafel (J.D. 2010) In einer Wahrheitwertstafel kann man die Korrektheit logischer Aussagen tabellarisch auflisten. Hierbei werden den einzelnen Aussagen (z.B. a und b) Wahrheitswerte zugeordnet (in der Regel w für ›wahr‹ und f für ›falsch‹) und somit angezeigt, ob der jeweilige Sachverhalt besteht oder nicht. Die Wahrheitswerte von zusammengesetzten Sätzen, welche mit Junktoren wie und oder oder verknüpft werden, sind dabei von den Wahrheitswerten der Teilaussagen abhängig. So ist eine Aussage a und b dann wahr, wenn beide Teilaussagen a und b wahr sind. Der Wahrheitswert für die Gesamtaussage kann entsprechend in einer weiteren Spalte angegeben werden.
Eine solche Wahrheitstafel zur *nicht ausschliessenden Disjunktion liegt dieser Illustration zugrunde:
Die logischen Verhältnisse wurden hierbei in einen leicht verständlichen technischen Ablauf übertragen. Zwei parallel geschaltete Wasserhähne repräsentieren die Wahrheitswerte der Teilaussagen, ein Kontrollrädchen den Wahrheitswert der Gesamtaussage. Ist eine Teilaussage wahr, so ist der Wasserhahn offen und das Wasser kann fliessen, bei geschlossenem Wasserhahn ist eine Teilaussage falsch. Um die Gesamtaussage wahr werden zu lassen, ist lediglich eine wahre Teilaussage notwendig. Für die Darstellung bedeutet dies, dass nur ein offener Wasserhahn notwendig ist, um das Wasser fliessen zu lassen und dadurch das Kontrollrädchen in Bewegung zu versetzen. Eine Visualisierung logischer Verhältnisse an Hand von Wasserhähnen ist jedoch nur für die nicht ausschliessende Disjunktion möglich. Bei der Konjunktion und führt bereits eine falsche Teilaussage zu einer falschen Gesamtaussage, bei der ausschliessenden Disjunktion oder (a oder b, aber nicht beides) ist die Gesamtaussage falsch, wenn beide Teilaussagen wahr sind. In einer technischen Übertragung wie dieser würde in beiden Fällen jedoch Wasser fliessen und fälschlicherweise das Kontrollrädchen angetrieben werden. Spezialliteratur Frege, Friedrich Ludwig Gottlob (1879), Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens (Halle: Nebert). Massey, Gerald J. (1970), Understanding symbolic logic (New York [u.a.]: Harper & Row). ›Aussagenlogik‹ in: Historisches Wörterbuch der Philosophie; Band 1. A-C (1971). Ritter, Joachim, Karlfried Gründer und Gottfried Gabriel (Hrsg.), (Basel: Schwabe), Sp. 672-678. |
|||||||||||||||||
Objekt: Aussage mit QuantorAussagen wie "Alle P sind q" oder "Einige P sind q" oder "Es gibt mindestens ein P" oder "Kein P ist q" oder "P ist nicht Q" können als Venn-Diagramm visualisiert werden. Hier theoretisch:
Hier in einer naturwissenschaftlichen Anwendung (stammesgeschichtliche Systematik des Tierreichs):
|
|||||||||||||||||
Objekt: Aussagenverbindung, logischer SchlussBeispiel: Syllogismus
|
|||||||||||||||||
Objekt: Zuordnung von Elementen aus verschiedenen Sphären••• Beispiel für die Visualisierung einer Relation, nämlich zwischen Zeit und Ort: Die Bewegung der Planeten durch die Tierkreiszeichen im Lauf der Zeit. Die Planeten sind oben mit Pictogrammen angegeben: v.l.n.r.: Luna – Mercurius – Mars – Iupiter – SOL usw. Die Spaltenangaben (Abszisse) benennen die Zeichen des Zodiak: v.r.n.l.: A Pisces – B Aries – C – Taurus – usw. bis M – Aquarius. (Darunter sind die Monate angegeben). Die Ordinate bezeichnet die Anzahl Jahre, die es dauert, bis ein Planet seinen Lauf vollendet hat.
|
|||||||||||||||||
Objekt: BauplanBeispiel: Der (ideale) Bauplan einer gotischen Kathedrale:
Beispiel: Damit die Desoxyribonukleinsäure funktionsfähig ist, hat sie eine genaue Struktur; eine Summenformel genügt zum Verständnis nicht, man muss die Struktur zeigen:
Spezialliteratur: Christoph Lüthy, The Invention of Atomistic Iconography, in: Wolfgang Lefèvre / Jürgen Renn / Urs Schoepflin (Hgg.), The power of images in early modern science, Basel/Boston/Berlin: Birkhauser 2003, pp. 117–138. Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonukleinsäure |
|||||||||||||||||
Objekt: Phasen eines zeitlichen AblaufsDas Objekt ist überschreitet hier die (sprachliche) Satzgrenze; die einzelnen beschreibenden Sätze werden mit dann oder sonst u.ä. verbunden Beispiel: Kontinentalverschiebung vom Kambrium bis heute
Beispiel: Allometrisches Wachstum Das Bild zeigt drei Stadien in der Entwicklung des menschlichen Embryos bis zum Säugling. Die Veränderungen der relativen Größen der Körperteile nennt man allometrisches Wachstum. Das Bild zeigt keine Verzerrung, sondern die Größenverhältnisse werden genau abgebildet. Durch die Nebeneinanderstellung wird die Veränderung der Proportionen ersichtlich.
Beispiel: (Rekonstruierter) Bewegungsablauf eines Sauriers unter Wasser vom Liegen über das Fressen bis zum Atemsprung:
Beispiel: Phasen einer Erzählung In der Imagerie d’Épinal im Elsass wurden im 19. Jh. viele Bildergeschichten produziert (vgl. die Digitalisate auf gallica.bnf.fr; ebenso bedeutsam sind die Münchener Bilderbogen (Hinweis).
+ Vgl. das Kapitel Bildvielheit |
|||||||||||||||||
Objekt: Beziehungen zwischen EinzelelmentenBeispiel: Personenkonstellation in einem Drama werden durch Linien visualisiert. (Heute noch als Unterrichtshilfe im Fach Deutsch gelegentlich verwendet.)
Beispiel: Handelsbeziehungen zwischen Staaten
|
|||||||||||||||||
Objekt: Prozess-Ablauf, Wirkungsgefüge, FunktionszusammenhangViele Objekte sind nur als Ablauf sinnvoll zu beschreiben: z.B. der Blutkreislauf im Körper — ein Fabrikationsablauf — der Instanzenweg beim Gericht usw. Objekt sind nicht nur um zeitliche Abfolgen; es enthält auch Aussagenverbindungen wie "A wirkt auf B" oder "wenn A —> dann B" u.a.m. Der Visualisierer kann entweder den Betrachter dem Vorgang folgen lassen (Pfeile im Bild) oder eine Art Trick-Film herstellen, dessen Bilder nebeneinander gelegt werden. Beispiel: Rückkoppelungsschleifen für Bevölkerung, Kapital, Landwirtschaft und Umweltverschmutzung
+ Mehr dazu im Kapitel zu den Prozessdiagrammen |
|||||||||||||||||
Objekt: Mathematische FunktionIn der darstellenden Geometrie werden mathematische Funktionen visualisiert. Beispiel: Parabel Bilde alle Punkte in einem Koordinatenstem (x/y) ab, welche diese Bedingung erfüllen: y = a • x 2 + b • x + c |
|||||||||||||||||
Objekt: Quantitäten in RelationenZahlenmaterialien, Relationen von Zahlenmengen können bildlich umgesetzt werden in Tabellen und Graphiken (Balkengraphiken, Pie Charts).
Immer wieder wurden solche statistischen Graphiken mit Pictogrammen angereichert, wobei die Verständlichkeit nicht zwingend zunimmt:
Bereits W. Cope Brinton und dann Otto Neurath haben diese Darstellungstechnik verworfen: such cards are misleading, weil die wirklichen Größenverhältnisse den Figuren nicht entnommen werden können.
+ Vgl. dazu das ausführliche Kapitel zu Tabellen |
|||||||||||||||||
Objekt: IntelligibiliaAls Intelligibilia gelten Abstrakta, die nur über den Verstand oder die Vernunft erfasst werden können. Zur Visualiserung muss der Begriff konkretisiert und ein Spezialfall davon dargestellt werden. Beispiel: Der Raum Das Kapitel im 6.Buch / 1. Traktakt in der »Margarita Philosophica« von Gregor Reisch (1503) befasst sich mit dem (geometrischen) Körper und seinen Eigenschaften (De corpore et eius speciebus). (Die Kapitel im Buch sind als Dialog zwischen einem Schüler und einem Magister gestaltet.) Der Magister definiert einen Körper über die drei Dimensionen des Raums, wörtlich als ›eine Länge mit einer Breite und Tiefe‹ (Corpus – Est longitudo cum latitudine et profunditate), und verweist darauf, dass sich in einem Körper drei Linien in einem Punkt orthogonal schneiden. Um diese Definition in ihrer Dreidimensionalität zu veranschaulichen, werden die in der rein wörtlichen Erklärung diffus erscheinenden Eigenschaften auf den menschlichen Körper übertragen. (Das Wort corpus bezeichnet ja den abstrakten geometrischen Körper wie den menschlichen Leib.) Der Magister wählt hierzu das Gedankenspiel einen Menschen, der von durchbohrt wird. Je nach Ein- und Austrittsstelle würde entweder die Länge (Scheitel und After), Tiefe (Brust und Rücken) oder Breite (die eine und die andere Körperseite) gemessen. Vt si lancea una per verticem capitis humani intraret et per anum exiret: metiretur longitudinem. et alia intrans per pectus et exiens in dorso metiretur profunditatem. et tertia intrans per latus unum et exiens per aliud metiretur latitudinem. (Insofern als wir sensorisch oben/unten – vorn/hinten – links/rechts empfinden, wird plausibel, dass die drei Dimensionen orthogonal zu einander stehen.)
Anmerkung: Ein auf den ersten Blick ähnliches Bild hat Hieronymus Wierix in Kupfer gestochen. Hier sind die aus allen Richtungen auf den nackten Mann eindringenden Schwerter ebenfalls nicht physisch, sondern "symbolisch", indessen völlig anders gemeint. Der Sünder wird gepeinigt durch die Sünde, den Teufel, den Wurm, den Tod:
|
|||||||||||||||||
Objekt: Psychologischer / moralischer BegriffBeispiel: Der Zorn Der Begriff wird hier visualisiert, indem der physiognomische Ausdruck eines Zornigen gezeigt wird.
Floerken zitiert hier Charles Le Brun [(1619–1690), Conference de Monsieur LeBrun Sur Expression generale et particuliere, Enrichie fig. gravées par B. Picart, Amsterdam / Paris 1698.]:
Spezialliteratur: Jennifer Montagu, The expression of the passions. The origin and influence of Charles Le Brun's Conférence sur l'expression générale et particulière, New Haven: Yale Univ. Press 1994. Beispiel: Der Mut (Courage) Der Begriff wird hier in eine exemplarische Geschichte umgesetzt; dieses Narrativ kann dann gezeichnet werden: Mut ist, wenn einer beispielsweise …
Beispiel: Die Gefræßigkeit Das Laster (im lateinischen Katalog der 7 Laster: gula) wird hier allegorisch umgesetzt in Tiere, die für ihre Fresssucht berühmt sind:
|
|||||||||||||||||
Objekt: Deontischer SatzGemeint sind Sätze, die Warnungen, Verbote, Erlaubnisse, Auffoderungen, Gebote usw. ausdrücken. Mit dem deontischen Operator wird bereits eine Funktion der Aussage / ihrer Visualisierung angestrebt; + mehr dazu im Kapitel zu den Funktionen. ••• Beispiel: Das Gebot Non occidas – Du sollst nicht töten:
••• Beispiel: Rachgier ist ein dummes Verhalten Das Emblem von Christof Murer (1558–1614) und Johann Heinrich Rordorff (1591–1680) verdeutlicht, anhand des Bären, der – von einer Biene gestochen – den ganzen Bienenkorb umwirft, dass Rachgier aus geringem Anlass Unheil anrichtet:
|
|||||||||||||||||
Objekt: Historisches EreignisGeschichtsbücher sind oft illustriert. Dabei entspringt die Darstellung – wenn es sich nicht um den Augenzeugenbericht eines "embedded journalist" handelt – der Phantasie der Graphiker. Der Illustrator stellt eine »sich ereignete unerhörte Begebenheit« dar (Goethe im Gespräche mit Eckermann am 29.1.1827). Verschiedene Visualisierungs-Techniken sind möglich:
••• Beispiel: Am 7.11.1492 schlug in der Nähe von Ensisheim ein ca. 127 kg. schwerer Meteorit ein. Conrad Lycosthenes notiert zu diesem Jahr:
••• Beispiel: Hannibals Zug über die Alpen (anno 218 v.u.Z.) wird von Livius so spektakulär geschildert, dass er immer wieder zu Visualisierungen angeregt hat. Livius, »ab urbe condita« (Buch 21, ¶ 31–39. Erwähnt werden die Elefanten in ¶ 34,5 und 35,1).
|
|||||||||||||||||
Objekt: Mythische GestaltDie Darstellung kann beruhen entweder auf Visionen von Anhängern der entsprechenden Religion oder auf Zeugenaussagen von Menschen, die das Wesen beschreiben. ••• Beispiel: Vishnu als eine göttliche Gestalt im Hinduismus
••• Beispiel: Der apokalyptische Drache In der Apokalypse wird (12,3f.) geschildert, dass ein siebenköpfiger Drache das Kind der kreißenden Frau auf der Mondsichel verschlingen will:
Eine weitere Szene beschreibt, wie die Erdenbewohner dem siebenköpfigen Tier huldigen (Apk. 13, 1–8):
Aus religiöser Scheu wird die visuelle Darstellung göttlicher Wesen in vielen Kulten untersagt. |
|||||||||||||||||
Objekt: VisionDas Wort Vision stammt ab von lat. video "ich sehe"; es bedeutet: Was sich den Augen (ggf. in der Phantasie) darstellt.
Spezialliteratur Lieselotte E. Saurma-Jeltsch, Die Miniaturen im »Liber scivias« der Hildegard von Bingen. Die Wucht der Vision und die Ordnung der Bilder. Wiesbaden 1998. Christel Meier, Zum Verhältnis von Text und Bild bei Hildegard von Bingen, in: Hildegard von Bingen 1179 – 1979, Festschrift zum 800. Todestag, hg. A. Brück, Mainz 1979, S. 159–169. |
|||||||||||||||||
Objekt: Nicht bildlich DarstellbaresGewisse religiöse Größen dürfen nicht als Bild realisiert werden. (Vgl. Exodus = 2.Mos 20,4–5). Wie verhält sich ein Graphiker, der eine biblische Szene illustrieren soll, wie diese:
Adam im Paradies mitten unter den Tieren, das lässt sich leicht zeichnen. Aber der Schöpfer? Matthäus Merian zeigt das Vor-Bild von Adam in Gestalt des Gottesnamens: Der Text (das Tetragramm JHWH) ersetzt also ein Bild – und dieser Text seinerseits darf nicht ausgesprochen werden! (Beim Lesen der Bibel spricht man als Ersatzwort aus: Adonai.)
+ Mehr zu diesem Thema in diesem Kapitel. |
|||||||||||||||||
Objekt: UnbekanntesDer niederländische Seefahrer Abel Tasman (1603–1659) erforschte 1642–1644 die Terra Australis incognita. Er vermaß die Küsten — diejenigen Teile, die er nicht erforschen konnte, zeichnete er als einfache Linie ein; vgl. Wiki Commons. (In der Wiedergabe bei Spamer ist diese weggelassen.)
Ähnlich ehrlich: nichts zeichnend, wo man nichts weiss: Landkarte nach Herman Moll (ca. 1654 – 1732):
|
|||||||||||||||||
Objekt: Fiktionales Narrativ••• Ovid erzählt (Metamorphosen II, 569–588), Coronis, die Tochter des Königs Coroneus, als sie am Gestade des Meeres gewandelt sei, habe Neptun sie wegen ihrer Schönheit verfolgt, und nur durch Minervas Hilfe, die die Fliehende in eine Krähe verwandelt habe, sei sie gerettet worden.
Illustratoren seit dem 16. Jh. haben die Momente visualisiert, wo ein Mensch in ein Tier verwandelt wird, und halb noch Mnesch, halb bereits Tier ist.
••• Die »Divina Commedia« von Dante wurde oft illustriert. Hier der zweite Kreis des Inferno (Canto 5):
|
|||||||||||||||||
Objekt: Imaginiertes (zu realisierendes) GebildeSolche Bilder haben – abgesehen davon, dass die belustigend wirken – auch die Funktion, die Phantasie anzuregen. Das in der Lufft seeglende Schiff wird von Eberhard Werner Happel (1647–1690) selbst als Project bezeichnet, das indessen nicht bloß erdichtet / sondern auff einem guten Grund beruhe:
|
|||||||||||||||||
Objekt: (Von einer Figur im Bild) Gesagtes / GedachtesDas Gesagte oder Gedachte kann vom Restbild klar abgegrenzt dargestellt werden, indem es textlich ausgedrückt wird und/oder indem es von einem Rahmen / einer Banderole / einer Wolke umgeben gezeigt und der sprechenden oder denkenden Figur zugeordnet wird. + Mehr dazu im Kapitel zu den Bild-Text-Verknüpfungen Beispiel, in dem der Unterschied deutlich wird zwischen dem außerhalb des Bilds angebrachten Rede-Text und dem ins Bild integrierten. Die Szene ist das Urteil Salomons (1. Könige 3,16–28), wo die Aussagen der beiden Frauen wörtlich wiedergegeben werden. Hier sind die zentralen Redeteile so verdeutscht:
|
|||||||||||||||||
erste Fassung: Januar 2021 PM |
|||||||||||||||||