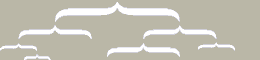
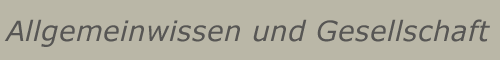
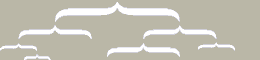 |
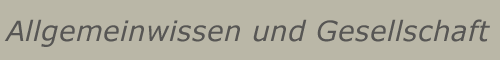 |
Bild – Sprache |
Unterschiede zwischen den Medien Bild und Sprache
Wissen kann im ›Medium‹ der Sprache oder des Bildes (und auch über andere Sinne, das lassen wir hier weg) vermittelt werden.
Welches Medium ist überlegen? Einige Überlegungen älterer Autoren dazu: ••• Segnius irritant animos demissa per aurem quam quae sunt oculis subiecta fidelibus (Horaz, Ars poetica 180f.) (Ch. M. Wieland übersetzt so: Was durch die Ohren in die Seele geht, rührt immer schwächer, langsamer, als was die Augen sehen.) ••• Immer wieder falsch verstanden wird die Wendung Ut pictura poesis, (Horaz, Ars poetica 361) --- das "ut" meint nicht, dass die Dichtung die Malerei imitieren solle.
••• … weil die Menschen mehr den Augen als den Ohren trauen – quia homines amplius oculis quam auribus credunt (Seneca, epist. I, vi, 5) ••• Cicero, de oratore II, lxxxvii,357:
••• Durandus (O.P. † 1296), Rationale, Liber primus, Caput tertium, ¶ 4:
••• Samuel a Quiccheberg, Inscriptiones Vel Titvli Theatri Amplissimi, Complectentis rerum vniuersitatis singulas materias et imagines eximias, […], München: Adam Berg 1565. – Darin »Digressiones et Declarationes«
Außer Betracht fällt hier die künstlerische Dimension:
Vgl. hierzu: Alice Thaler, Von ontologischen Dualismen des Bildes. Philosophische Ästhetik als Grundlage kunstwissenschaftlicher Hermeneutik, Basel: Schwabe 2015. (http://www.zora.uzh.ch/id/eprint/135324/) |
||||
Hinweise zu dieser SeiteZur Information über die verwendeten linguistischen Begriffe vgl. Hadumod Bußmann, Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart: Kröner (KröTa 452) 2002. Einen Eindruck von der Komplexität der Sprache gibt die vorzügliche Homepage von Christian Lehmann (Universität Erfurt) > https://www.christianlehmann.eu/ling/lg_system/index.php {Mai 2022} Öfters zitiert wird hier: Gotthold Ephraim Lessing: Laokoon. Oder: Über die Grenzen der Mahlerei und Poesie. Mit beyläufigen Erläuterungen verschiedner Punkte der alten Kunstgeschichte, Berlin: bey Christian Friedrich Voss, 1766. > http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00074585/image_3 Mit solchen Zitaten wird die Paragone-Diskussion berührt, aber hier nicht vertieft; vgl. > https://de.wikipedia.org/wiki/Paragone_(Kunsttheorie) Literatur zum Thema:
Überblick: Das Gebiet ist schwer zu systematisieren, Wiederholungen und Verschachtelungen sind unvermeidbar, und so ist die Anordnung der Unterkapitel etwas ›rhapsodisch‹. – Unter der Regierung der Vernunft dürfen unsere Erkenntnisse überhaupt keine Rhapsodie, sondern sie müssen ein System ausmachen […]. Immanuel KANT, »Die Architektonik der reinen Vernunft« > http://www.zeno.org/nid/20009189289 Einleitung: Extreme und Grade I. Basis-Elemente und Grund-Struktur der beiden Medien II. Einschränkungen / Potentiale III. Welche Inhalte können in welchem Medium besser repräsentiert werden? IV. Welche logischen Operationen können in welchem Medium besser repräsentiert werden? V. Rezeptions-Psychologie / Wahrnehmungs-Logik VI. Rhetorische Mittel VII. Barrierefreie Kommunikation mittels Bildern ? |
||||
Einleitung: Extreme und Grade••• Es gibt Wissensbestände, wo nur das eine der beiden Medien zur Repräsentation wirklich taugt. • Nur im Medium der Sprache lassen sich Wissensbestände fassen wie:
• Komplexe natürliche Strukturen lassen sich brauchbar nur im Medium des Bildes darstellen.
••• Es gibt Wissensbestände, wo das eine der beiden Medien einen Mehrwert bringt, weil es das Wissen weniger umständlich, schneller, einleuchtender, eindringlicher repräsentiert. Das sind die für unser Thema besonders interessanten Fälle. • Erstes Beispiel: Die Beschreibung des Kardangelenks in Pierers »Universal-Lexicon« 1864 ist so präzis, dass man es nachbauen kann.
• Zweites Beispiel: Im Text kann man die Fahrzeiten angeben; im Bild (topological diagram) ist dafür die räumliche Lage der Destinationen erkenntlich. (Das baucht nicht zwingend der Fall zu sein, vgl. die Londoner U-Tube Map.)
• Drittes Beispiel: Deontische Aussagen (vgl. unten; z.Bsp. ein Verbot) kann man im Medium Sprache wie im Medium Bild ausdrücken. Für das Verständnis beider Medien braucht es entsprechende Vorkenntnisse:
Die Überlegenheit des einen der Medien ist auch abhängig vom Menschentyp. Es gibt Leute, die finden sich in einer Stadt besser zurecht mit einer Wegbeschreibung, andere mit einem geographischen Plan. |
||||
I. Basis-Elemente und Grund-Struktur der beiden MedienI. 1 Zweifache Gliederung I. 2 Lexikon I. 3 Motivé — arbitraire I. 4 Abstrakta I. 5 Obligatorischer Ausdruck von Partner-Beziehungen (›Valenz‹) I. 6 Thema—Rhema innerhalb des / z.T. im Text I. 7 Anordnung der Teile I. 8 Kontext-Abhängigkeit (semantische Ebene / pragmatische Ebene) I. 9 Einige Bau-Elemente des Bilds |
||||
I. 1 Zweifache GliederungJede natürliche Sprache ist auf zwei Ebenen gegliedert. Vgl. André Martinet, Éléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin, 1960. Sie kennt • kleinste bedeutungs-unterscheidende Einheiten (Phoneme; umgangssprachlich und vereinfacht: Laute); das Deutsche hat etwa 40 Phoneme; • kleinste bedeutungs-tragende Einheiten (umgangssprachlich und vereinfacht: Wörter); der Wortschatz der deutschen Standardsprache umfasst ca. 75’000 Wörter. Auf den Lauten beruhen die Wörter; auf den Wörtern beruhen die Sätze; auf den Sätzen beruhen dann die Texte. Das Medium Bild kennt keine zwei solchen Ebenen. (Die Analogie: Laute ≈ Linien, Flächen, Farben // Wörter ≈ abgebildete Gegenstände ist unsinnig.) Allenfalls gibt es so etwas in der Biologie: Aus Atomen sind Aminosäuren gebaut, wovon es 20 gibt // aus Aminosäuren ist die große Anzahl von Peptiden gebaut. > http://www.seilnacht.com/Lexikon/amino.html {Februar 2017} |
||||
I. 2 LexikonIm Medium Sprache gibt es ein endliches Inventar semantisch abgegrenzter Wörter. (Ein etwa 15-jähriger Muttersprachiger kennt ca. 12’000 Wörter.) Der Wortschatz ist komplex, geschichtet (verschiedene Wortarten mit ihren besonderen Leistungen; Synonyme, Homonyme, Hyponyme, Hyperonyme, Antonyme usw.). Im Medium Bild gibt es kein exaktes Analogon zum Wortschatz. In unserem optischen Wahrnehmungsapparat haben wir ein riesiges Arsenal von mehr oder weniger schematischen Bildern, anhand derer wir konkrete Dinge (wieder-)erkennen. Bei Gesichtern ist die Präzision maximal präzis – bei anderen Dingen, z.B. beim Konzept ›Hund‹ ist die Bildidee so offen, dass wir alle Rassen darunter subsumieren können. Je nach Vorbildung sind die Konzepte differenzierter (ein Gärtner kann Sträucher genauer unterscheiden als ein Laie). Die Bildideen sind außerdem in lebensweltliche Konfigurationen eingebettet. – Das alles gilt nur für mimetische Bilder, und die Analogie zum Wortschatz ist oberflächlich. Immer wieder ist versucht worden, eine Art Bild-Lexikon zu etablieren. So wurden – vor allem von den Ikonologen des 16. bis frühen 18. Jahrhunderts – Sammlungen von abgegrenzten bedeutungstragenden Bildelementen erstellt, etwa antike Gottheiten (Beispiel: Vincenzo Cartari, Imagini De Gli Dei Delli Antichi, 1556) oder Allegorien, die als Ausdrucksmittel in der bildenden Kunst verwendet wurden (Beispiel: Cesare Ripa, Iconologia, 1593 u.ö.). – Die moderne Weiterentwicklung ist ICONCLASS, ein Klassifikationssystem für die ikonographische Beschreibung von Bildern mit ca. 14’000 Keywords > http://www.iconclass.org/help/outline Hier ein Beispiel:
Erwähnt werden sollen die umfangreichen Werke von Filippo Picinelli, »Mundus Symbolicus« (1653) und Jacobus Boschius, »Symbolographia« (1701). Moderne Nachfolger sind Tafeln von allerhand Pictogrammen, Emoticons, Verkehrssignalen u.ä. |
||||
I. 3 Motivé / arbitraireDie Unterscheidung hat für die Linguistik prominent herausgestellt Ferdinand de Saussure (1916). Es lässt sich parallelisieren
••• Im Medium Bild ist die Beziehung zwischen dem Dargestellten und dem Gemeinten entweder ›mimetisch‹ (in der trivialisierten Theorie von Charles Sanders Peirce: »icon«):
Auch veristische / mimetische / wirklichkeitsgetreue Abbildungen beruhen auf einer Transformation zwischen der Wirklichkeit und dem Bild; d.h. sie beruhen auf einem modellartigen Verhältnis. Oder die Beziehung zwischen dem Dargestellten und dem Gemeinten beruht auf Konvention; wir sprechen von diagrammatischen Visualisierungen (Peirce: »symbol«):
Zur Abstraktionsreihe von mimetisch bis arbiträr vgl. das im Kapitel Pictogramme Gesagte. ••• Im Medium Sprache: Zwischen der »image acoustique« und dem »concept« (Ferdinand de Saussure 1916) besteht in der Regel keine naturnotwendige Beziehung, die Lautgestalt eines Wortes bildet das damit Gemeinte nicht ab; man sagt: das Verhältnis ist ›arbiträr‹. (Eine seltene Ausnahme bilden die onomatopoetischen Wörter wie kikeriki.) > https://fr.wikipedia.org/wiki/Signe_linguistique Bei wissensvermittelnden Visualisierungen begegnet oft ein Konglomerat von mimetischen Elementen und diagrammatischen. Die folgenden Graphiken enthalten sowohl am wirklichen Aussehen von Dingen orientierte Abbildungen als auch (arbiträre) diagrammatische Zeichnungen in Kombination. • Das Flugzeug und die Erdoberfläche ist – naturalistisch – photographiert; darübergelegt sind die diagrammatischen Zeichnungen der Lichtstrahlen, der lichtempfindlichen Medien und der Gebiete, die sie abbilden.
• Schema zur Wirkungsweise eines Mikrophons:
|
||||
I. 4 AbstraktaIn den indoeuropäischen (und anderen) Sprachen gibt es Abstrakta, salopp gesagt: Wörter, mit denen etwas Ungegenständliches bezeichnet wird. Das ist linguistisch/ontologisch ein weites Feld. Wir müssen uns beschränken. Hier nur éin Typ der Bildung von Abstrakta im Deutschen:
Im Bild können einige Abstrakta mit bestimmten Tricks auch ausgedrückt werden. • Ein in Bildwörterbüchern oft anzutreffender Fall ist die Bildung von Hyperonymen durch eine Bildvielheit von Hyponymen, die der Betrachter verallgemeinern muss. Beispiel der Sprung:
• Eine andere Technik ist die Personifikation. (Vgl. das Unterkapitel zu den rhetorischen Mitteln.) Was mit einer Personifikation gemeint ist, geht aus ihrem Bild kaum hervor. Es ist ein (sprachlich notiertes) Vorwissen nötig. Lessing schreibt im »Laokoon« (1766; Kapitel X):
Beispiel: Cesare Ripa (* um 1555; † 1622) personifiziert die Unbeständigkeit:
|
||||
I. 5 Obligatorischer Ausdruck von Partner-BeziehungenMindestens in den indoeuropäischen Sprachen gibt es das Phänomen der Kookkurrenz und der Valenz. Wörter fordern Ergänzungen verschiedener Art: • semantisch: Das deutsche Verb gießen verlangt als Gegenstand etwas Flüssiges / streuen etwas Fest-Körniges (Obwohl der Vorgang sehr ähnlich aussieht, ist *Sand gießen falsch; ebenso *Wasser streuen. Im Englischen geht to pour für beides.) — Im Englischen kann man für deutsch ›groß‹ sagen a large man; a huge man; a great quantity – aber nicht *a large fear; *a huge pain; *a great income.
• morphologisch: Jeder Satz enthält ein Verb. Verben müssen konjugiert werden, d.h. mit dem Subjekt übereinstimmen, ein Tempus und evtl. einen Aspekt ausdrücken u.a.m. • syntaktisch: Verben verlangen Objekte in gewissen Kasûs; beispielsweise Caesar [Nominativ] Cleopatram [Akkusativ] amat. (Wenn die Personen-Bezeichnungen mit anderen Kasus versehen sind, ändert sich der Sinn oder der Satz wird ungrammatisch.) Auf dem System beruhende obligatorische Partner-Beziehungen gibt es im Medium Bild nicht; indessen Kombinationen von Bildteilen, die in der Wirklichkeit nicht zusammengehören. In solchen Fällen nimmt der Betrachter an, es handle sich um eine Metapher (siehe dann unten):
... oder um eine absichtlich vom Bildgestalter herbeigeführte Irritation, einen Scherz:
Mehr zur Metaphorik unten |
||||
I. 6 Thema-RhemaSprachliche Äußerungen folgen dem Topic-Comment-Prozess, was von der linguistischen Textanalyse beschrieben wird. »Thema« ist die bereits bekannte (z.B. durch den eben gelesenen Text vorgegebene) Information; »Rhema« ist die neue Information; Thema und Rhema zusammen bilden die Aussage. Das gilt sowohl in der Mikrostruktur (auf Satzebene: Subjekt – Prädikat) als auch in der Makrostruktur (auf Textebene*). Der Forscher sah einen Löwen.Der Löwe fraß eine Antilope, *) In einem impressionistischen Gedicht kann die Anordnung der Elemente andern Prinzipien folgen: Es ist belanglos, wann der böse rote Löwe und wann der Hirsch und wann der weiße Elefant im Karussell vorbeizieht. Die Thema-Rhema-Struktur ist nicht eine ›wahrnehmungsmechanistische‹ Kategorie, sondern eine logische. Bei einem Bild gibt es keine solche durch das Medium auferlegte Progression. Man könnte einwenden, es gebe doch trickfilm-artige Bildreihen. Die Reihe hat hier indessen die Struktur ›A und dann B und dann C usw.‹ und nicht die Struktur von Thema und Rhema. |
||||
I. 7 Anordnung der ElementeWort-Abfolge-Regeln sind grammatisch bestimmt. (Hier als Beispiel die deutsche Sprache; schon im Lateinischen ist das bekanntlich anders …) Man kann auch bei vehementem Aussage-Willen aus diesem Korsett nicht herauskommen. Durch die bloße Umstellung eines Wortes kann sich die Bedeutung des Satzes vollkommen ändern:
Weitere Beispiele
Auch stilistisch kann die Wortabfolge eingesetzt werden. Wegen der zwingenden Diskursivität kann auf diese Weise die Aufmerksamkeit gelenkt werden. So schreibt Thomas Mann zu Beginn des Josephsromans:
Der Leser hat so zuerst den Eindruck von Tiefe und denkt nicht wie im trivialen Fall an irgend einen Brunnen in einem Garten oder zur Viehtränke. Die Regeln sind im einzelnen sehr kompliziert, vgl. etwa Ulrich Engel, Deutsche Grammatik, Heidelberg: Groos 1988, S. 303–355. Sehr interessant ist das Buch von Judith Macheiner, Das grammatische Varieté oder Die Kunst und das Vergnügen, deutsche Sätze zu bilden, Frankfurt am Main: Eichborn 1991 (Die andere Bibliothek). Im Medium Bild (wir sprechen von wissensvermittelnden Bildern) ist die Anordnung der Elemente durch folgende Kriterien bedingt: ••• durch die Logik der Sache:
••• durch anthropologische Vorgaben. Bei der Visualisierung von hierarchischen Strukturen empfinden wir normalerweise oben mit ›wertvoller‹, ›mächtiger‹. So sind bei Organigrammen die leitenden Stellen/Personen oben lokalisiert, die gehorchenden, ausführenden ›unter‹-geordnet.
Die Symbolik von oben und unten leitet auch das Bild der Lebenstreppe: Der ›Zenit‹ des Menschen ist oben, dann folgt der ›decline‹ (von lat. declinare = sich neigen). (Dass der Ablauf der Lebensphasen von links nach rechts erfolgt, ist kein anthropolog. Universale, sondern beruht auf der kulturellen Praxis der Leserichtung. Im hebräischen Kulturraum sind die Säuglinge rechts.)
••• durch ästhetische Vorstellungen. Bei gewissen Inhalten lassen sich die Teile beliebig (Beispiel die Tiere bei Zahn) oder ornamental (die Muscheln bei Seba) anordnen.
••• Im Zusammenhang mit dem Thema der Anordnung der Elemente muss darauf hingewiesen werden, dass es eine konventionalisierte Richtung der Blickfolge gibt; in den europäischen Schriftsystemen – also auf dem sprachlichen Medium beruhend – von links nach rechts. |
||||
I. 8 Kontext-Abhängigkeit(1) Semantisch: Sprache. Das Wort Absatz hat je nach Kontext eine andere Bedeutung:
Das Phänomen gibt es auch im Medium Bild. Im Bild links verhüllen Wolken den Horizont; die Bergspitze links hinten erscheint höher zu sein. Im Bild rechts zeigt der ferne Horizont, dass der Betrachter über den beiden nahen Spitzen steht und auf diese hinabblickt, so dass der nähere Gipfel höher erscheint als der fernere.
(2) Sprechaktmäßig: Ludwig Wittgenstein (1889–1951) schreibt in den »Philosophischen Untersuchungen« (erste, zweisprachige Publikation 1953):
War dieser Artikel im Brockhaus seine Inspirationsquelle?
Ebenso wie ein Bild erst in seinem Kontext (linguistisch exakter: ›Kotext‹, als Einbettung in eine Redesituation) seine »illocutive force«* erhält, ist es in der Sprache. Derselbe Satz
meint im Kotext
*) John L. Austin, Zur Theorie der Sprechakte, dt. Bearbeitung von Eike von Savigny, (RUB 9396–98), Stuttgart 1972 (engl. How to Do Things with Words, Cambridge/Mass. 1962) |
||||
I. 9 Einige Bau-Elemente von Bildern
Freundliche Grüße von Piet Mondrian Die Basiselemente sind • Linien (die verschieden dick und auch als Pfeile ausgebildet sein können, die zu Netzen o.ä. ausgebildet sein können); vgl. das Unterkapitel Linien • (geformte, gegenseitig voneinander abgegrenzte) Flächen • Farben (oder funktionsadäquate Mittel wie Rasterung) • der Ort des Elements auf der Zeichenebene bzw. die relative Position von Elementen zueinander. • Weitere Elemente dienen der Raumillusion.
Im Gegensatz zu den natürlichen Sprachen kennt das Bild keine Regeln für obligatorische Partner; keine Thema-Rhema-Beziehung; keine Regeln für die Anordnung der Teile. (Seltene Ausnahme: In der Heraldik darf nie Metall neben Metall [Silber, Gold], nie Farbe neben Farbe stehen.) In Wissen visualisierenden Graphiken haben diese Basiselemente oft andere Funktionen als beispielsweise in der Landschaftsmalerei. (Hier gibt es beispielsweise die Technik, mittels Farbe Ferne darzustellen, weil blaustichige Farben, wie wir sie am Horizont wahrnehmen, als ›fern‹ erscheinen.) Oder in der Ikonographie, wo z.B. Purpur als imperiale Farbe gilt. • Auf einer geologischen Karte entsprechen die Farben nicht den wirklichen Farben der Gesteine. (Bei einer Klimakarte dagegen wird man die ariden Gebiete braun und die fruchtbaren Wiesen grün darstellen.)
• Die Schraffur kann bei einem mimetischen Bild zur Darstellung der Plastizität einer runden Form und des Schattens eingesetzt werden. Beispiel:
• Die Schraffur kann aber auch diagrammatische Funktion haben. Im Beispiel: Die Schlange ›sieht‹ mit speziellen Organen am Kopf Infrarot-Strahlung, und zwar stereoskopisch. In der Zeichnung ist das Gesichtsfeld des linken und rechten Organs verschieden gerastert, so dass die Überschneidungszone deutlich wird.
Literaturhinweise zum Thema Bild-Elemente in wissensvermittelnder Literatur: Jacques Bertin (1918–2010), Sémiologie Graphique. Les diagrammes, les réseaux, les cartes, Paris: Mouton 1967 und Neuauflagen und Übersetzungen. Robert L. Harris, Information Graphics. A Comprehensive Illustrated Reference, New York: Oxford University Press 1999. > http://books.google.ch/books?id=LT1RXREvkGIC |
||||
II. Einschränkungen / PotentialeAus den Bauelementen und Strukturprinzipien ergeben sich in jedem der beiden Medien gewisse Einschränkungen; bzw. das jeweilige Medium auferlegt Regeln. Umgekehrt eröffnet jedes der beiden Medien Freiräume, hat ein besonderes Potential. Zwei Felder sind besonders wichtig: II. 1 Schematisierung – Zwang zum Konkreten II. 2 Diskursiv – simultan |
||||
II. 1 Schematisierung – Zwang zum KonkretenDie Sprache (die Eigennamen ausgenommen) schematisiert: Bereits simple Wörter wie Hund, Gabel, essen, kurz fassen etwas Allgemeines, erst recht die sogenannten ›Abstrakta‹ wie Geist, Nation usw. Im Gegensatz zum Medium Sprache tut sich das Medium Bild mit dieser Schematisierung schwer. In einem Text kann man einfach schreiben »Ein Junge trat ins Zimmer.« Bei der bildlichen Darstellung muss der Graphiker entscheiden, ob er ihn barhäuptig oder mit einer Kopfbedeckung zeigt. Es stellt sich die Frage: Was kann man in welchem Medium unausgedrückt lassen / was muss man darstellen? • Erstes Beispiel: Die Definition von Klammer mittels Sprache lässt sich abstrakt fassen als eine Vorrichtung zur jederzeit lösbaren Verbindung zweier Teile. Das Bild erlaubt das nicht: es müssen die verschiedenen Ausprägungen gezeigt werden, und der Betrachter hat eine Abstraktionsleistung zu erbringen. — Im Abschnitt über die Klammer in der Arithmetik ist aber das Medium Bild praktischer, um die Typen (), [], {} zu unterscheiden!
• Zweites Beispiel: Im Medium Sprache kann man sagen: Ich habe einen Aurora-Falter gesehen. Im Medium Bild muss man wegen des Geschlechtsdimorphismus des Tiers ein Weibchen und ein Männchen (nur bei ihm ist die äußere Hälfte der Vorderflügel orange gefärbt) zeigen, d.h. auch hier die Technik der Bildvielheit wählen. Das Medium Bild zwingt den Graphiker, gewisse Dinge darzustellen, die für das Visualisierungsinteresse nicht von Belang sind. • Drittes Beispiel: Zur Darstellung des Tonfilmateliers muss der Graphiker irgendeine Szene, die hier gedreht wird, zeichnen; dass es gerade ein Ritter-Film ist, trägt zur Information nichts bei. Der Graphiker rechnet damit, dass der Betrachter solche Züge ausser Acht lässt – in unserem Beispiel kann er davon absehen, dass statt der Szene mit dem die Dame anflehenden Ritter auch eine beim Abendbrot sitzende Familie gefilmt werden könnte.
Kulturelles (Essen, Kleidung, Wohnen, Verkehr usw.) muss kulturspezifisch dargestellt werden. Das wird deutlich beim Vergleich von Bildwörterbüchern aus Europa und China. Mit der Zeit wurden graphische Techniken entwickelt, um eine gewisse Schematisierung zu erreichen. • Silhouette. Der Schattenriss abstrahiert das vollplastische Objekt auf das (den Graphiker interessierende) Wesentliche. Berühmt sind die Portraits von Lavater. (Mehr dazu im Kapitel über Linien.)
• Umrissliniendarstellungen (die den Vorteil haben, weniger zu konkretisieren und Teile im Vagen zu belassen) wurden entwickelt, namentlich von John Flaxman (1755–1826; Illustrationen zur Ilias, Odyssee, Divina Commedia). Beispiel: Der Graphiker hat die Gesichter und die Umgebung weggelassen, weil man ihnen keine Aufmerksamkeit schenken und den Blick auf die Kleidung lenken soll. Die Betrachterin soll nicht sagen können: ›Schau mal diese prächtige Landschaft, in der diese Leute wandern!‹ oder ›Der Lautenschläger schaut aber etwas missmutig drein.‹
• Eine andere Technik ist das graphische ›Freistellen‹ (engl. ›cropping‹), das heisst die Befreiung eines Motivs von einem störenden Hintergrund; damit soll sichergestellt werden, dass der Betrachter vom Umfeld und anderem Beiwerk nicht abgelenkt wird. Beispiel: Bei den Rachenmustern von Vögeln wird der Kopf des Vogels selbst weggelassen, weil sein Aussehen (den Leser des Buchs ebenso wie den Jungvogel) nicht interessiert:
|
||||
II. 2 Diskursiv – simultanDiskursiv (von lat. discurro ›durchlaufen‹); simultan (von lat. simul ›zugleich‹) – Vgl. ähnlich Susanne K. Langer (1942) Der Text ist an die Linearität gebunden und gängelt den Leser zwangsläufig beim Lesen von Wort zu Wort. Erst nach dem Aufarbeiten der Details lässt sich der Inhalt verstehen. Man denke an den alten Witz der französischen Simultandolmetscher aus dem Deutschen (beim Nebensatz): »Attendez le verbe!« In einem Bild kann man den Blick willkürlich gleiten lassen, beispielsweise bei der Darstellung der Anordnung der Speisen auf dem Tisch beim »Service à la Française« (im Ggs. zu ›à la Russe‹). (Die Nummern schreiben nicht vor, in welcher Reihenfolge man das Bild anschauen soll; sie dienen nur dem Verweis auf die Legende. Nicht nur der Betrachter des Bilds lässt den Blick schweifen, auch der Betrachter der wirklichen Speisen auf dem Tisch …)
Die Blickbewegungsabfolge beim Betrachten eines Bildes ist nicht durch die Struktur des Bildes bestimmt wie bei der Sprache (hier eben zwingend linear), sondern durch die Psyche des Betrachters und sein Interesse, sie ist auch gender-spezifisch. Der russische Psychologe Alfred Lukyanovich Yarbus (1914–1986) hat Blickbewegungen untersucht:
Die Analyse der Blickbewegungsabfolgen beim Betrachten eines Bilds ist für die Werbe-Industrie von Bedeutung; vgl. dazu die Stichwörter eye tracking und Blickverlaufsanalyse und die interessante Homepage http://eyetracking.ch/wahr-oder-falsch {28.08.2016} Es gibt auch Bildtypen, wo dem Betrachter eine ›Leserichtung‹ nahegelegt wird, z.B. bei Prozessdiagrammen und ähnlichen Bildern mittels Numerierung und Pfeilen.
Lessing (»Laokoon«, 1766, Kapitel XVI bis XVIII) schreibt:
Er nennt den »Kunstgriff«, mit dem der Dichter es fertigbringt, Gegenstände mediengerecht zu präsentieren: »Was das Auge mit einmal übersiehet, zählt er uns merklich langsam nach und nach zu, […]« (XVII), d.h. er transformiert den Gegenstand in Handlung. Das prägnanteste Beispiel ist der [Lessing: das] Schild des Achill im 18. Gesang von Homers »Ilias« (Verse 478–603).
Ein kurzer Ausschnitt aus Homer (in der Übersetzung von Johann Heinrich Voß 1793 )
|
||||
III. Welche Inhalte können in welchem Medium besser repräsentiert werden?III. 1 Komplexe räumliche Strukturen III. 2 Bewegung, Abläufe, vorher – nachher III. 3 Tempus III. 4 Vergleich ähnlicher / analoger Objekte III. 5 Typisierungen III. 6 Schlüsselreize III. 7 Semantik |
||||
III. 1 Komplexe StrukturenInsbesondere wenn eine räumliche Struktur gezeigt werden soll, ist das Medium Bild eindeutig überlegen.
Moderne technische Geräte sind so kompliziert, dass sie das Medium Bild verlangen:
|
||||
III. 2 Bewegung, Abläufe, vorher – nachherDas Medium Bild scheint hier – mit technischen Tricks verwendet – in gewisser Hinsicht dem Medium Sprache überlegen zu sein. ••• Man kann das sich vor einem Hintergrund bewegende Objekt in einer Art Stroboskop-Fotografie oder Langzeit-Fotografie abbilden. Frank Bunker Gilbreth (1868–1924) wollte – im Sinne der Unternehmensphilosophie des Taylorismus – diejenigen Bewegungsabläufe, die nicht einem optimalen Arbeitsablauf dienen, eliminieren. Dazu befestigte er Lämpchen an Armen und Händen von Arbeiter(inne)n, ließ sie ihre Arbeit verrichten und machte photographische Langzeitaufnahmen. — Durch die Technik von Gilbreth ist das Bild der Bewegung eines Dirigenten inspiriert:
••• Man kann die aufeinanderfolgenden Phasen in einer Reihe von Einzelbildern eines Films wie einen Cartoon chronologisch aneinanderreihen.
Zu erinnern ist an die Reihenfotografien von Eadweard Muybridge (1830–1904) und Étienne-Jules Marey (1830–1904). |
||||
III. 3 TempusTest: Die beiden folgenden Bilder beschreiben Flugzeuge. Welches beschreibt ein vergangenes Ereignis, welches ein zukünftiges? A: B: Ergebnis: Einem Bild sieht man nicht an, ob ein vergangenes oder zukünftiges Ereignis gemeint ist. Dazu sind Hintergrundsinformationen oder ein begleitender Text nötig. A beschreibt Alexanders Luftfahrt, die keineswegs als Utopie aufgefasst wurde, sondern als sich ereignete Begebenheit. Alexander der Große ließ sich ein Gefährt konstruieren, an das er hungrige Greifen band, die er mit einem Aas köderte, so dass sie ihn in die Luft trugen.
B beschreibt das Projekt für ein künftig zu bauendes Flugzeug »La Passarola« von Bartolomeu Lourenço de Gusmão (1685–1724).
Im Medium Sprache (in den indoeuropäischen und semitischen Sprachen, andere kennt der Verf. nicht) gibt es die Möglichkeit, das Tempus auszudrücken. |
||||
III. 4 Vergleich ähnlicher / analoger ObjekteDas Nebeneinanderstellen von Bildern ähnlicher Objekte ist der sprachlichen Ausformulierung der Unterschiede überlegen, weil wir mit dem Gesichtssinn feinste Unterschiede schnell wahrnehmen können, während eben die Sprache generalisiert, typisiert. (Vgl. hierzu das Kapitel Bildvielheit)
Die Objekte können zwecks Vergleich statt nebeneinander auch übereinander dargestellt sein.
Vgl. hierzu speziell das Kapitel Bildvielheit. |
||||
III. 5 TypisierungFrancis Galton (1822–1911) wollte physiognomische Typen darstellen. Er verwendete dazu das Verfahren der »composite photography«: Die Negative mehrerer Portraits einer Personengruppe belichtete er übereinander auf dasselbe Papier. So entstanden leicht verschwommene Bilder, die gerade kein individuelles Abbild darstellten, sondern einen Typ. Composite portraits made by combining those of many different persons into a single figure, 1878.
Eine andere Technik der Typisierung ist die Karikatur:
Im Medium der Sprache lassen sich ebenso typische Figuren schildern, vgl. Thomas Manns Portrait der Romanfigur Bendix Grünlich (»Buddenbrooks«, 3.Teil):
|
||||
III. 6 SchlüsselreizeDem Medium Sprache sind deutlich überlegen bildliche Gestalten, die als »Schlüsselreiz« eine bestimmte Emotion auslösen. Man stelle sich vor, das La Colère äußernde Gesicht von Charles Le Brun (1619–1690) würde sprachlich geschildert: Könnten wir dann sofort den Affekt erkennen, der darin aufscheint?
Die – umständliche, schwerfällige – sprachliche Variante findet sich etwa in der Enzyklopädie von Krünitz:
Literaturhinweise zum Begriff ›Schlüsselreiz‹: Irenäus Eibl-Eibesfeldt, Der vorprogrammierte Mensch. Das Ererbte als bestimmender Faktor im menschlichen Verhalten, Wien: Molden 1973. Irenäus Eibl-Eibesfeldt / Christa Sütterlin, Im Banne der Angst. Zur Natur- und Kunstgeschichte menschlicher Abwehrsymbolik, München: Piper 1992. |
||||
III. 7 SemantikBedeutungen von Wörtern, die Realia bezeichnen, können mittels Ostensivdefinition anhand eines Bilds schnell erklärt werden.
Siehe die spezielle Seite zu den Bildwörterbüchern. |
||||
IV. Welche logischen Operationen können in welchem Medium besser repräsentiert werden?IV.1 Deixis IV. 2 Logische Verhältnisse IV. 3 Deontische Aussagen IV. 4 Negation IV. 5 Meta-Aussagen IV. 6 Ungewissheit, Näherungen |
||||
IV. 1 DeixisDie Sprache kennt ›deiktische‹ Ausdrücke. Damit (von griech. deíknymi = ich zeige) verweisen wir als Sprecher auf eine Person / einen Ort / ein Objekt. Ausdrücke hierfür sind etwa: dieses, jenes, hier, dort, das folgende, … Deixis kann bildlich umgesetzt werden, indem man in einem unübersichtlichen Ensemble mit einem Pfeil (vgl. das Kapitel zu Linien und Pfeilen) auf das gemeinte Objekt zeigt. Wir kennen das neuerdings von den seltsamen Pictogrammen, die auf Google Maps (und Abkömmlingen) zeigen: »Hier ist das Gesuchte«!
Die Frage der Deixis hat indessen noch einen interessanteren Aspekt: Mit einem deiktischen Ausdruck kann man nur auf ein Individuum, ein Einzelexemplar verweisen, nicht auf eine Klasse von Objekten. Wie zeigt ein Bild, welche der beiden Aussagen aktuell der Fall ist? Es gibt beispielsweise Elefanten-Individuen, die als solche hervortraten: der Elefant Hanno (gest. 1516); der 1629 in verschiedenen deutschen Städten gezeigte Elefant; der Elefant Soliman (gest. 1553); der Elefant Hansken (gest. 1655); der Zirkuselefant, der am 29. Juni 1866 in Murten ausrastete und durch eine Kanonenkugel erlegt wurde. Im Bild ist nicht erkennbar, ob ein deiktisch hervorgehobenes Individuum oder die Klasse gemeint ist; das muss durch Beischriften oder durch den Kontext (z.B. Flugblatt zu einem datierten Ereignis) geleistet werden.
Das Auftreten des Bilds in der Textsorte ›Biologiebuch‹ (Buffon, Brehms) macht deutlich, dass das Generische gemeint ist.
|
||||
IV. 2 Logische VerhältnisseDer Wortschatz der Sprache enthält Autosemantika (damit werden Einheiten des Wortschatzes bezeichnet, welche eine vom Kontext unabhängige und selbständige lexikalische Bedeutung aufweisen, sich landläufig gesagt auf Dinge in der Welt beziehen), ferner Hilfswörter mit grammatischer Funktion (z.B. die Artikel im Deutschen), schließlich logische Operatoren wie (prädikatenlogisch) alle, einige; (aussagenlogisch) wenn — dann, weil usw. Im Medium Bild sind logische Verhältnisse nur über Umwege darstellbar. Eine Technik ist die Umsetzung in ein Narrativ, das dann visualisiert werden kann. Der Betracher muss aber die Logik selbst aus seinem Sachwissen beisteuern (ggf. nach dem Prinzip ›post hoc, ergo propter hoc‹). Beispiel Kaufkraft. Als Kaufkraft bezeichnet man den Wert des Geldes einer Währung in Bezug auf die Menge der Waren, die man dafür kaufen kann. Die damit zusammenhängenden Begriffe Steigen / Fallen / Gleichbleiben der Kaufkraft sind in den drei für sich stehenden Bildern jeweils als ein Narrativ umgesetzt worden. Dabei geht es auch um die Darstellung eines Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs.
Dabei wirken zwei Bild-Komponenten zusammen.
|
||||
IV. 3 Deontische AussagenIn der Sprache kann man mit einfachen Mitteln deontische Aussagen (es ist erlaubt, du darfst nicht) formulieren. Es gibt einige Tricks, wie man im Medium Bild solche Aussagen machen kann. Sie beruhen auf vorausgehender (sprachlich bewerkstelligter) Instruktion, sind dem Bild selbst nicht zu entnehmen. ••• Eine verwerfliche mythologische Gestalt rät einer Person zu einer Handlung, die verboten ist. Hier rät ein Teufelchen zu töten (wider das fünfte Gebot).
••• Es wird ein Zusammenhang zwischen dem moralisch verwerflichen Tun und einer noch schlimmeren Folge beschrieben, was visualisiert werden kann. (J.D.) Der ›Feiertagschristus‹ ist ein Bildmotiv, das im späten 14. und 15. Jahrhundert an Kirchenwänden angebracht wurde. Das Bild weist auf das Verbot der Feiertagsarbeit hin (Ex 20, 8–11; Deut 5, 12–15), indem es zeigt, dass die sonntägliche Arbeit Christus ebenso grausam verwunden würde wie die Geisselung und Kreuzesnägel während der Passion. Dargestellt wird dazu der nur von einem Lendentuch bekleidete Christus, umgeben von bäuerlichen und handwerklichen Arbeitsgeräten und Alltagsgegenständen, welche ihm andeutungsweise oder konkret Verletzungen beibringen.
••• Dass David sündigte, als er Bathseba begehrte (2.Samuel = II. Reg, Kapitel 11), wird von Tobias Stimmer (1539–1584) dadurch herausgestellt, dass er einen Affen bei der Szene zuschauen lässt, wie David die Badende betrachtet. (Der Affe kommt in der Bibel in dieser Szene nicht vor. Der Betrachter muss die Einschätzung dieses Tiers als töricht kennen; vgl. hierzu Horst W. Janson, Apes and ape lore in the Middle Ages and Renaissance, (Studies of the Warburg Institute 20), London 1952.)
••• Der deontische Begriff – zum Beispiel Mitleid – kann zunächst in eine exemplarische Geschichte umgesetzt werden; dieses Narrativ kann dann gezeichnet werden. Kleine Nuancen (wie ein Gesichtsausdruck) verstärken das deontische Moment.
••• Pictogramme sind eine junge Erscheinung.
|
||||
IV. 4 NegationDass etwas nicht der Fall ist, lässt sich sprachlich leicht sagen – die philosophischen Probleme in diesem Zusammenhang sind allerdings beträchtlich.* Lässt sich in einem Bild darstellen, was es (noch) nicht gibt?
——— *) Vgl. Peter Schulthess: Die Realität der Finsternis im dunkelsten Mittelalter. Viel Lärm und nichts oder viel Lärm um das Nichts? in: Gestalt und Gestaltungen eines Gestalters (Neujahrsblatt der Gelehrten Gesellschaft in Zürich auf das Jahr 2014), hg. von Kurt R. Spillmann, Zürich: Verlag episteme.ch 2014; S. 83–104. |
||||
IV. 5 Meta-AussagenIm Medium Text sind Meta-Aussagen leicht möglich: Ein Text(-Stück) kann selbst wieder Thema des Redens sein (zum Beispiel: Diese Aussage ist folgendermaßen zu verstehen: ...). In Titelbildern von wissenvermittelnden Publikationen werden gelegentlich Objekt- und Meta-Ebene simultan dargestellt oder kontaminiert, wie hier, wo Gelehrte über verschiedene Arten von Vögeln (Objekt-Ebene) diskutieren (Meta-Ebene). Der Betrachter kann aber dem Bild nicht einfach entnehmen, dass all diese Vögel sich in einer anderen Bildebene befinden als die beiden Gelehrten.
Aussagen über Aussagen kommen in narrativen Bildern vor. Beispielsweise, wenn in einer Darstellung einer träumenden Person deren Traum gezeigt wird. Im Nibelungenlied (Fassung A: Strophen 13–14 und 18/4–18; B: Strophe 11; C: Strophe 12; siehe die Parallel-Ausgabe von M. Batts > https://books.google.ch/books?id=NxnW6pZzRIEC&pg=PA4) wird erzählt:
|
||||
IV.6 Ungewissheit, NäherungenDie Sprache kennt zur Beurteilung der Realität der Aussage durch den Sprecher / zur Stellungnahme des Sprechers zur Geltung des Sachverhalts verschiedene Mittel:
Der Sprecher kann die Genauigkeit von Maßen einschränken: ungefähr, annäherungsweise, beinahe, circa, etwa, schätzungsweise, approximately, roughly, nearly, usw. Darwin schrieb über die erste Skizze der korallenartigen Verzweigungen, die die Entstehung der Arten visualisierten: I think. Das linguistische Problem ist sehr komplex, vgl. etwa Bei gewissen Bildtypen ist es möglich, Ungewissheit zu markieren. Bei (ehrlichen) Messungen wird der (engl.) range (dt. die Spanne) angegeben:
Das Schweizerische Bundesamt für Statistik hat im Oktober 2016 eine »Enquête sur la langue, la religion et la culture« publiziert. Das Balkendiagramm zeigt, in welcher der drei großen Sprachregionen welche Fremdsprachen regelmäßig gesprochen werden. Es steht hier als Beispiel für sorgfältigen Umgang mit Daten:
Mimetische Bilder insinuieren, dass es das abgebildete Objekt gibt, und dass es so aussieht, wie das Bild zeigt. Mit welcher Technik kann der Graphiker seine Ungewissheit klarmachen? Nicht gefüllte Flächen oder farbig hervorgehobene Materialien zeigen bei Rekonstruktionen von Baudenkmälern oder paläozoologischen Skeletten, welche Ergänzungen sich der Autor bloß vorstellt; leer gelassene Flächen zeigen, wo der Kartograph das Gebiet nicht kennt.
Da kommen einem die Verse von Jonathan Swift in den Sinn (»On poetry. A Rhapsody.« 1733)
|
||||
V. Rezeptions-Psychologie / Wahrnehmungs-LogikWir kennen Ausdrücke wie: Eye catcher — etwas ist augenfällig — cela saut aux yeux — Anschaulichkeit — evident (von lat. video = ich sehe), die die psychische Wirkmächtigkeit des Bildes thematisieren. Worauf beruht diese? Das Kapitel überschneidet sich zwangsläufig mit II. 2 diskursiv – simultan und III. 6 Schlüsselreize. V. 1 Orientierung auf der Fläche V. 2 Schnelles Wahrnehmen komplexer Situationen V. 3 Mnemotechnische Hilfe Auf die Blickbewegungen wurde oben schon eingegangen. |
||||
V.1 Orientierung auf der FlächeBilder können die anthropologische Grundfähigkeit der Orientierung im Raum ausnützen. Dazu gehört, dass wir z.B. Winkel und Flächen gut abschätzen können, während wir dasselbe Verhältnis, wenn es in Zahlen angegeben wird, nicht schnell durchschauen. (Das Abschätzen von Winkeln wird möglicherweise durch das Ablesen der Uhr eingeübt; ob junge Leute, die an Digitaluhren gewöhnt sind, das auch so gut können?) Hier die Handelsbilanz von Belgisch-Kongo 1927: Diese Fähigkeit nützt die Pie Chart aus; vgl. dazu das Kapitel zu den Tabellen.
|
||||
V. 2 Schnelles Wahrnehmen komplexer SituationenIn einem Bild kann eine ganze Situation schlagartig (eben ›augenblicklich‹) erkennbar gemacht werden, indem ein »prägnanter Moment« (Schiller an Goethe, 15. September 1797) gezeigt wird. Beispiel: Security Warnung Auf dieser Warntafel wird eine Situation gezeigt, das Konzentrat einer kleinen Geschichte, die zu erzählen umständlich wäre. Die Fahrgäste im Bahnhof sollen die Warnung unverzüglich verstehen.
Beispiel: Gefahren des Kleinkinds
Was genau in der Szene geschieht, wenn man ein Bild mit einem prägnanten Moment sieht, ist nicht immer eindeutig. Was tut der Erzengel Michael hier?
Nein: Der Engel zieht das Schwert nicht! Papst Gregor der Große soll die Erscheinung des Erzengels Michael gesehen haben, der ihm das Ende der Pest verkündete, indem er das Schwert des göttlichen Zorns in die Scheide steckte. Lessing sprach vom fruchtbaren Augenblick (»Laokoon«, 1766, Kapitel III. [nicht genau in diesem Wortlaut]) und sagte dazu: »Je mehr wir sehen, desto mehr müssen wir hinzu denken können. Je mehr wir darzu denken, desto mehr müssen wir zu sehen glauben.« |
||||
V. 3 Mnemotechnische HilfeJe nach Veranlagung können Menschen sich sprachliche oder bildliche Gefüge besser einprägen. In früheren Zeiten, als man viele Texte auswendig lernte, war die sprachliche Fähigkeit besser geschult; heute wird das optische Gedächtnis forciert.
Die Leistungen der beiden Medien kann man abschätzen, wenn beide parallel dargeboten werden. Hier ein Beispiel aus einem bebilderten »Sachsenspiegel« des Eike von Repgow, entstanden zwischen 1220 und 1235: Dem nächtlichen Korndieb ist – wegen der Heimlichkeit seiner Tat – die schändlichere Todesart bestimmt; der Dieb, der am Tag ein größeres Risiko eingeht, wird mit der ehrenvolleren Strafe, der Enthauptung, bestraft.
Als Erfinder der Mnemotechnik gilt Simonides von Keos, aufgrund folgender Anekdote. Man kann sich Dinge einprägen mittels ihrer räumlichen Situation, d.h. einer bildlichen Vorstellung:
Überliefert bei Quintilian, inst. or. XI, ii, 11ff: tum Simonides dicitur memor ordinis quo quisque discubuerat corpora suis reddidisse. English translation by H. E. Butler, 1920/1922 > http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Quintilian/Institutio_Oratoria/home.html Cicero, de oratore II, lxxxvii, 357 bringt die Anekdote ebenfalls und schreibt dazu:
Polydorus Vergilius behandelt die Gedächtniskunst in seinem Werk »de inventoribus rerum« (2.Buch, 9.Kapitel). Der Petrarcameister, der den Druck der deutschen Übersetzung illustriert, stellt zwei Figuren einander gegenüber: Die Frau rechts wird belastet durch ein Buch auf dem Kopf und macht eine betrübte Miene; der Herr rechts zeigt souverän mit der Hand auf 14 Medaillons mit Bildern, anhand derer er sich offenbar einen Sachverhalt eingeprägt hat.
Seit dem 15. Jahrhundert entstehen Traktate, die aufzeigen möchten, wie man sich anhand von Bildern Sachverhalte einprägen kann.
Literaturhinweis: Jörg Jochen Berns / Wolfgang Neuber u.a., Ars memorativa. Zur kulturgeschichtlichen Bedeutung der Gedächtniskunst 1400–1700, (Frühe Neuzeit 15), Tübingen: Niemeyer 1993. |
||||
VI. Rhetorische MittelVI. 1 Metapher VI. 2 Insinuation VI. 3 Bild-Text-Verbund, ›Bimedialität‹ |
||||
VI. 1 MetapherDas Phänomen Metapher kurz erklärt (anhand des Mediums Sprache): Ein Wort, das gewohnheitsmäßig in einen bestimmten Weltausschnitt gehört, wird aktuell in einem anderen gebraucht, so, dass das dort zu erwartende in einem neuen Licht gesehen wird. Mit dem metaphorisch verwendeten Wort und dem zu erwartenden Wort kann ein Satz gebildet werden von der logischen Struktur ›A ähnelt B.‹ (Solche Hilfen werden von mittelmäßigen oder allzuvorsichtigen Verfassern auch in den Text gesetzt.) Beispiel: In einem Bericht über Universitäts-Ereignisse steht: Nach der Vorlesung verließ Prof. M. den Tempel. Eigentlich zu erwarten wäre: den Hörsaal. Zum aktuell schräg verwendeten Wort Tempel assoziieren wir: priesterliches Gehabe; weihevolle Zeremonien, elitäre Sprache; diese Vorstellungen werden auf die Welt der Hochschule, insbesondere auf Prof. M. projiziert. In wissensvermittelnden Publikationen kommen visualisierte Modelle vor (die logisch dasselbe sind wie die Metaphern in der Sprache). Seriöserweise wird angegeben, dass es sich beim Bild um ein Modell handelt. — In rhetorisch orientierten Medien (Embleme, Cartoons, Karikaturen, Werbung u.a.m.) sind Bildmetaphern beliebt. Erstes Beispiel: Es ist offenkundig, dass niemand eine Mitra und einen Kardinalshut in die eine Waagschale legt, und eine Sanduhr und eine Sense in die andere. Das muss metaphorisch gemeint sein: Die Ehrenämter werden gewogen und (gegenüber der Vergänglichkeit) als ›zu leicht befunden‹ (vgl. Buch Daniel, Kap.5).
Zweites Beispiel: Die Aussage ›ist gut zu verteidigen‹ wird metaphorisch als Festung umgesetzt und diese in eine Landkarte der Schweiz (= der nicht-metaphorische Kontext) integriert.
Weitere Beispiele sind die von Paolo Garretto in den 30er Jahren für das »Vanity Fair Magazine« gezeichneten Cartoons, z.B. das Capitol, das eine Brille und Doktorhut (mortarboard) trägt, um den Einfluss der intellektuellen Berater auf die Politik und Präsident Roosevelt 1934 zu visualisieren. |
||||
VI. 2. InsinuationInsinuation von ›in sinu habere‹, d.h. im Busen versteckt halten: geheime listige Mitteilung einer Nachricht, Einflüsterung einer Meinung; insinuieren: jemandem etwas auf eine feine Art beibringen. Erstes Beispiel: Für den Stärkenvergleich der Marinen Englands und Deutschlands sind die Tonnagen der Flotten in Bilder von Schiffen umgesetzt und diese so voreinander gestellt, dass das die Stärke der englischen Marine darstellende Schiff das kleinere deutsche ›verdrängt‹. Würden nur die Zahlen wiedergegeben, so käme dieser Eindruck kaum zustande.
Zweites Beispiel: David Herrliberger (1697–1777) stellt eine Hochzeitstafel vornehmer Bürger in Zürich dar: Nôces de Personnes de Condition
Die Brautleute tafeln, artig zugeknöpft. Oben an der Wand über der Uhr ist ein Bild angebracht, das zeigt, wie der bockfüßige, gehörnte, geile Pan einen Vorhang zurückzieht und eine schlafende Nymphe überfällt (vgl. Ovid, Metamorphosen I, 689ff.). Das Bild gleicht der Darstellung der Szene in der »Hypnerotomachia Poliphili« (rechts, aus der Ausgabe Hypnerotomachie, ou Discours du songe de Poliphile, Paris 1546); es würden sich viele Vorlagen finden lassen. Dieselbe Idee hatte bereits Philipp von Zesen (1619–1689) in seiner »Adriatischen Rosemund« 1645: Er hängt unkommentiert Bilder an die Wand: Im Zimmer der Adelmund – einer Freundin der Hauptheldin –, wo die beiden Verliebten (Rosemund und Markhold) sich sehen und er vom Coup de foudre getroffen wird, befinden sich allerlei Kunstgegenstände: Ein bildlich verzierter Leuchter, ein Decken-Gemälde mit dem Motiv der beiden von Vulcan ertappten Venus und Mars, und über dem Kaminsims ›Sinnenbilder‹, wovon das eine so beschrieben wird:
Im Medium des Textes ist es schwieriger, auf diese Weise Unterstellungen zu machen, weil man hier nichts ungesagt sagen kann. Am ehesten verwandt sind stillschweigende Übernahmen von Bauformen, Textmustern. Ein weiteres Beispiel für eine moderne bedeutungsvolle Anspielung im Bild: ein Parkhaus oder ein Kühlturm wird als Turm von Babel gezeichnet (so der Graphiker Pierre Brauchli 1979). |
||||
VI. 3 Bild-Text-Verbund, ›Bimedialität‹Mittels Bild-Text-Verbund wird erreicht, die Vorteile der beiden Medien zu nutzen. Vgl. hierzu besonders die Seite zu Labels/Captions/Sprechblasen. Beispiel: Gebrauchsanleitung Hier wirken zusammen: mimetisches Bild + Pictogramm (Pfeil für die Bewegungsrichtung) + Beschreibung des auf dem Bild Sichtbaren + Anweisung in Textform. In den Sprechblasen werden die Texte beigegeben, die die Figuren sprechen oder denken, was im Medium Bild nicht realisiert werden kann. Die Figuren ihrerseits haben eine Mimik, die das Medium Sprache nur schwer wiedergeben kann. Das kennen wir aus der Lektüre in unserer Jugend. Die Technik ist älter:
|
||||
VII. Barrierefreie Kommunikation mittels Bildern ?Pictogramme – so werden sie angepriesen – kommen ohne Sprache aus. (Die Toiletten am Flughafen Keflavík waren anno 1975 angeschrieben mit Karlar | Konur. Durch welche Türe wären Sie eingetreten? Heute sind dort Pictogramme von Mann und Frau angebracht, so dass man kein Isländisch mehr können muss. – Aber man muss doch wissen, das einst Frauen Röcke trugen....) ••• Für Touristen werden Reisebegleiter angeboten, damit sie sich in Ländern verständigen können, deren Sprache sie nicht gelernt haben.
Allerdings: Wenn ich für meinen Gesprächspartner im Büchlein auf die Schwimmflossen zeige: Merkt er dann, ob ich sie ausleihen oder kaufen oder reparieren lassen oder verkaufen möchte? Oder: Ich möchte grüne Badehosen kaufen. Auch hier ergibt sich ein Problem: In einigen Sprachen (z.B. chinesisch, japanisch) wird ein Kontinuum von grün—blau mit einem einzigen Wort bezeichnet.
••• Um außerirdischen intelligenten Wesen mitzuteilen, wer wir Menschen auf der Erde sind, wurden 1972 auf Raumsonden Plaketten angebracht.
••• Unsere Nachkommen in 5'500 Jahren (wenn es solche geben wird) werden keine unserer Sprachen mehr verstehen. Wenn wir ihnen mitteilen möchten: »Achtung, hier befindet sich ein Endlager mit extrem giftigen atomaren Abfällen« – wie visualisieren wir das? Die International Atomic Energy Agency hat sich bereits 1984 Gedanken dazu gemacht > https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:16010246. Aber ob die Menschen dannzumal das dann verstehen? Z.Bsp. dieses Warnschild: Solche Versuche rechnen nicht damit, dass wir zum Verständnis von Bildern viel Vorwissen mitbringen müssen. Das ist nicht anders als bei Texten. (Hans-Georg Gadamer sprach von der »Vorurteilshaftigkeit alles Verstehens«, Wahrheit und Methode, 2.Aufl. 1972, S. 254ff.) Dabei handelt es sich teils um anthropologisches Basiswissen (dass die Dimension oben als wertvoller gilt), teils um Alltagserfahrung (dass Bälle rund sind, auch wenn sie im Bild als kreisförmige Fläche erscheinen), teils um gelerntes Wissen (wie man eine Tabelle liest), teils um kulturspezifisches Wissen. Zu letzterem nur ein einziges Beispiel: Der Stifter auf dem Bild von Stefan Lochner († 1451) vor dem hl. Antonius Eremita, dem hl. Cornelius und Maria Magdalena ist kein Zwerg, sondern er wird so klein dargestellt, weil er im Verhältnis zu diesen Heiligen als demütig-geringwertig erscheinen möchte.
Man muss für das Verständnis von Bildern ein Archiv von schematischen Bildern im Kopf haben und Techniken der Visualisierung kennen. Wie das wahrnehmungspsychologisch funktioniert? |
||||
PostscriptUnd deshalb hat Gott, der so sehr den Menschen liebt, dass er für ihn sorgen will, soweit er dessen bedarf, dem Menschen eine besondere Art von Seelenkraft gegeben, die Gedächtnis (memoire) heisst. Dieses Gedächtnis hat zwei Türen: sehen und hören; und zu jeder dieser beiden Türen führt ein Weg, auf dem man dorthin gelangen kann, nämlich Bild und Wort (ceste memoire si a .ij. portes, veir [veoir] et oir [oïr] , et a cascune de ces .ij. portes si a un chemin par ou i puet aler, che sont painture et parole). Richard de Fournival, 1201– ca. 1260; Le Bestiaire d’Amour et la Response du Bestiaire, éd. et trad. Gabriel Bianciotto, Paris, Champion [CCMA 27], 2009.
Im »Speculum sapientiæ« eines Autors des 14. Jahrhunderts (›Cyrillus‹) beklagt sich das Ohr bei der Natura, dass es im Gegensatz zum Auge nicht mit Lidern ausgestattet ist, die es beschützen. – Hier geht es um den moralischen Aspekt der beiden Medien: die Frage, welches Organ durch Unziemliches eher zur Sünde gereizt wird... • Ulrich von Pottenstein hat das Buch zu Beginn des 15. Jahrhunderts ins Deutsche übersetzt (erster Druck Augsburg: A.Sorg 1490) • Sebastian Münster (1488–1552) hat den Text ins Deutsche übersetzt: Spiegel der wyßheit, durch kurtzwylige fabeln vil schöner sittlicher und Christlicher lere angebende [Basel: Petri 1520] > http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00086964/image_1 • Das Speculum wurde dann vom Meistersinger Daniel Holtzmann (ca. 1546 – ca. 1613) in deutsche Knittelverse übersetzt und 1571 bebildert gedruckt: Spiegel der Natürlichen Weyßhait. Augsburg: Philipp Vlhart 1573 > http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00022848/image_1
Wer das lieber lateinisch lesen möchte:
Literaturhinweis: Romy Günthart, Sebastian Münster. Spiegel der wyßheit. Einführung, Edition und Kommentar, München: Fink (2 Bde.) 1996. (Text: I,68; Kommentar II,48f.) Friedrich Nietzsche, »Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne« (1873):
|
||||
|
Online gestellt im August 2016 von PM; Totalrevision Mitte Februar 2017. |
||||