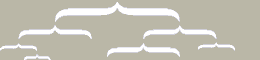
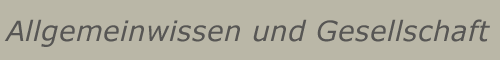
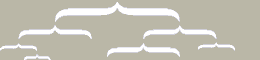 |
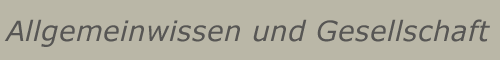 |
Bildvielheiten |
Bildvielheiten. SynopsenEinleitungDie hier behandelten Bilder zeigen Erscheinungen, die im Gegensatz zur Erfahrung stehen: • dass auf einem Bild dasselbe Objekt gleichzeitig mehrfach vorkommen kann; • dass auf einem Bild Objekte zusammen vorkommen können, die es in der Wirklichkeit nicht können (durch Ungleichzeitigkeit, zu große Entfernung, Inkompatibilität) oder die faktisch nicht oder selten auf die dargestellte Weise zusammen vorkommen. Im Focus der Betrachtung von Bildvielheiten steht hier einzig die Anordnung von Teilbildern und ihr Bezug untereinander; nicht, auf welche Weise diese Teilbilder selbst etwas darstellen. Das wird in anderen Kapiteln behandelt. Selbstverständlich kann dasselbe Bild unter verschiedenen Aspekten betrachtet werden. So wird beispielsweise der Typ Kompilationsbild einmal in der Rubrik ›Verhältnis Thema — Bild‹ behandelt, ein andermal unter der Rubrik ›logisches Verhältnis der Bildteile‹. Erster Fragekomplex: Das Verhältnis Thema — Bild
Anhang: Typographisch bedingte und ästhetische Darstellungstechniken Zweiter Fragekomplex: logisches Verhältnis der Bildteile
Dritter Fragekomplex: Kognitiver Mehrwert konkreter Fälle von Bildvielheit |
||||||||||
Erster Fragekomplex: Das Verhältnis Thema — BildIn diesem Abschnitt werden Formen der Vielheit auf der Bildebene nach den Kategorien Dimension, Ordnung und Verbundenheit (separiert / integriert) behandelt. |
||||||||||
|
Erster Fragekomplex: Das Verhältnis Thema — Bild 1. Eine Einheit auf der Objektebene wird als Vielheit auf der Bildebene dargestelltSeparierung von Aspekten: D’Alembert behauptet im »Discours préliminaire« (1751), im Gegensatz zu Ephraïm Chambers hätten die Verfasser der Artikel der »Encyclopédie« die Werkstätten besucht, um vor Ort einen Augenschein zu nehmen: On s’est donné la peine d’aller dans leurs atteliers, de les interroger, d’écrire sous leur dictée, de développer leurs pensées, d’en tirer les termes propres à leurs professions, d’en dresser des tables, […]. Solche mimetische Ansichten (oft sind sie allerdings irgendwo abgekupfert) werden gelegentlich mit technischen Konstruktionsplänen desselben Objekts zusammen dargeboten, wie bei diesem Pferdegöpel, der über ein Kammrad und zwei Ritzel und weitere Zahnräder die Walzstraße antreibt:
Separierung in Phasen: Beispiel: die Bewegung des Herzmuskels. Insofern als das Herz kontinuierlich schlägt, ist das Objekt als Einheit aufzufassen. Es wird vom Graphiker in den interessanten Phasen abgebildet, so dass eine Bildvielheit entsteht.
Separierung von Schichten (layers): Beispiel der Vierfarbendruck. Ein gedrucktes Bild ist aus vier Farben aufgebaut: CMYK = Cyan (blau) , Magenta (purpurrot), Yellow, Key (tiefschwarz). Genaueres hier >https://de.wikipedia.org/wiki/Vierfarbdruck Im Bild sind die Farben separiert, und die Zwischenresultate werden gezeigt.
Historischer Exkurs: Jakob Christoph Le Blon (1667–1741) hatte den Dreifarbendruck entwickelt. Dieser wurde durch die Zugabe einer schwarz druckenden Farbplatte [heute: Key] wesentlich verbessert durch Jacques-Fabien Gautier-Dagoty (1716?–1785). – Vgl. hierzu den Aufsatz von Sarah Lowengard, »Industry and Ideas. Jacques-Fabien Gautier, or Gautier d'Agoty« (2008) > http://www.gutenberg-e.org/lowengard/C_Chap12.html |
||||||||||
|
Erster Fragekomplex: Das Verhältnis Thema — Bild 2. Vielheit auf der Objektebene wird als Vielheit auf der Bildebene dargestelltEs stellt sich insbesondere bei dieser Gruppe das Problem der Anordnung der Bildteile, weshalb diese Techniken hier hervorgehoben werden. (Vgl. auch den Anhang zu den typographisch bedingten und ästhetischen Darstellungstechniken.) Bildhaufen A: Bunte Vielfalt. Die einzelnen Bilder sind ungeordnet; es besteht ein inhaltliches Sammelsurium. In älteren enzyklopädischen Werken ist das aus kommerziellen Gründen – wegen der teuren Kupferstiche – häufig, vgl. etwa den Tafelband (49 Kupferstiche im Querformat, Satzspiegel 39 x 24 cm) zur 2. völlig neubearbeiteten Auflage von Pierers Enzyklopädischem Wörterbuch der Wissenschaften unter dem Titel »Universal-Lexicon der Gegenwart und Vergangenheit«, 1848.
Bildhaufen B: Die ungeordnete Sammlung ist thematisch einheitlich.
Bildhaufen C: Eine seltsame Anordnung der Bild-Elemente hat Romeyn de Hooghe (1645–1708) für sein Werk »Hieroglyphica of Merkbeelden der oude volkeren« (EA 1735) gewählt. Die einzelnen Objekte sind nicht voneinander abgetrennt, sondern wie in einem ›Wimmelbild‹ durcheinander abgebildet, als würde er den heidnischen Polytheismus karikieren:
Ordnung durch segmentale Abgrenzung: Es gibt räumlich klar abgegrenzte Bildbereiche. Die Grenzen zwischen den Teilbildern werden von einem Rahmen oder durch Leerraum gebildet, wobei man Leerraum als virtuellen Rahmen auffassen kann.
Infolge der sach-inhärenten Logik kommt es zu höher organisierten Gestaltungen. Pragmatisch kluge Anordnung der Einzelbilder. Die einzelnen Teile des Gewandes, die dem Schneider als Vorlage dienen, sind so angeordnet, dass möglichst wenig Verlust an Textilien entsteht:
Abfolge in Leserichtung: Historische Entwicklung der Uniform eines preußischen Kürassierregiments von 1729 bis zum [Ersten] Weltkrieg:
Bedienungsanleitung, wie man eine Krawatte bindet. (Die Leserichtung ist bekanntlich kulturabhängig.)
Kreisförmige Anordnung: Biologischer Progress vom Ei über die Kaulquappe zum Frosch:
Die Bildteile sind in Form einer Tabelle zusammengefügt:
Die Bildteile sind in der Struktur eines Baums zusammengefügt: Beispiel der Stammbaum von Japhet und seinem Eheweib Funda (nicht biblisch). Die ›Wurzel‹ ist im Bild oben; die ›Verzweigungen‹ weisen nach unten:
Die Bildteile sind auf einer geographischen Karte angebracht:
Überblendung (engl. superimposition). Die Teilbilder können übereinander gelegt sein, als wären sie durchsichtig; es entsteht der Effekt einer Überblendung (Begriff aus der Kinematographie):
|
||||||||||
Erster Fragekomplex: Das Verhältnis Thema — Bild 3. Vielheit auf der Objektebene wird als Einheit auf der Bildebene dargestelltVgl. dazu auch das Kapitel >>> Simultane Szenen. Kompilation: Die Teilbilder von mit real nicht (so) zusammen vorkommenden Elementen sind so zusammengefügt, dass der Eindruck einer einheitlichen Bildwelt entsteht; es handelt sich um ein rein geistiges Arrangement. ••• Erstes Beispiel: Höhenvergleich bei Gebäuden
••• Zweites Beispiel: Verschiedene Krankheiten, die beim Menschen vorkommen Die Tafel zeigt einen Katalog von möglichen Erkrankungen an zwei Figuren (Frau und Mann). Die Frau weiset in dem rechten Aug ein pterygium oder Häutlein/ welches das Gesicht verhindert … In dem lincken Aug ein staphyloma, oder Gewächs … Hinder dem rechten Ohrläpplein ein Gewächs mit einem dünnen Grund … In der rechten Brust einen offenen Krebs-Schaden … An heimlichen Orten einen Fürfall des vordern Leibs usw.
••• Drittes Beispiel: Allerlei Tiere, die in einer Region vorkommen Es werden Tiere zusammen in einem Bild gezeigt, die in der Realität nicht zusammen vorkommen – sie leben in ganz verschiedenen Biotopen (und würden sich, wenn das Gezeigte real wäre, gegenseitig auffressen). • Schon in den frühen Reiseberichten (Breydenbach > http://diglib.hab.de/inkunabeln/288-12-hist-2f/start.htm?image=00282) gibt es solche Bilder. • Ein berühmtes Wimmelbild ist dieses: Meerwunder vnd seltzame Thier/ so in den Mitnächtigen Ländern im Meer vnd auff dem Landt gefunden werden.
• Und erstaunlicherweise noch im Konversationslexikon des frühen 20. Jahrhunderts:
<•> Kontrast-Beispiel: Verschiedene Tiere, die in einem Biotop vorkommen Im Gegensatz zum oben gezeigten ›Wimmelbild‹ ist hier eine biologisch realistische Lebens-Welt dargestellt:
Überlagerung von mehreren Bildern zu einem: Um zu zeigen, wie man sich die Lage der Kontinente Europa und Asien zur Zeit von Kolumbus vergestellt hat, wird der Behaim-Globus vom Jahre 1492 abgerollt und einer modernen Karte (in derselben Projektion) überlagert; Kontinente bei Behaim farbig; auf der modernen Karte weiß:
|
||||||||||
|
Erster Fragekomplex: Das Verhältnis Thema — Bild 4. Eine Einheit auf der Objektebene wird (zerlegt und wieder) als Einheit auf der Bildebene dargestelltStroboskop-Bild: Die begriffliche Einheit ›Sprung‹ wird (in der fotografischen Technik mittels des kurz hintereinander aufleuchtenden Blitzes) in Einzelbilder aus verschiedenen Phasen des Bewegungsablaufs zerlegt, und diese optischen Erscheinungen werden (auf demselben lichtempfindlichen Medium) als ein Bild übereinander kopiert. – Hier eine Vor-Form aus dem 18.Jh.:
Simultan-Bild: Bis ins 16.Jh. gab es Bilder, in denen zwei in derselben Narration aufeinanderfolgende Szenen in einem einzigen Bild gezeigt wurden. Dazu gibt es ein Unterkapitel >>> hier in neuem Fenster.
|
||||||||||
Anhang: Typographisch bedingte und ästhetische DarstellungstechnikenEs gibt durch den Inhalt und die Logik bedingte Darstellungsarten, aber auch solche, die äußerlich durch technische Bedingtheiten oder auch durch ästhetische Vorstellungen zustande kommen. Den letzteren ist dieser Anhang gewidmet Durch das Layout bedingte Darstellung Vergleich der Geschwindigkeiten vom Wachstum des Fingernagels (6,5 cm pro Jahr) bis zum Licht (300 000 000 Meter pro Sekunde). Die Rangliste wäre für eine Buchseite zu lang, so ist sie als Band geformt, das als Boustrophedon gestaltet ist. (Dass die Bilder so bei den gegenläufigen Bandteilen auf die Hinterseite zu liegen kämen, wird nicht berücksichtigt.)
Für solche Bilder sind gelegentlich Lesehilfen nötig. Beispiel für die die Lektüre unterstützende Technik mittels einer Linie, eines Pfeils und einer Ziffernfolge. Dies scheint hier angebracht, weil die Leserichtung in der unteren Zeile wechselt wie beim Boustrophedon:
Ornamentale Darbietung Der Graphiker hat sich hier den Spaß erlaubt, die einzelnen Einbrecherwerkzeuge ornamental anzuordnen; der Erkenntniswert der Bilder an sich bleibt hinter den im Artikel ausgeführten modernen Methoden (Fingerabdrücke; Bertillonsches Messsystem) zurück.
Ernst Haeckel hat in seinen »Kunstformen der Natur« (1899–1904) sehr oft die Lebewesen in eine ornamentale Ordnung gebracht. Im Vorwort (1899) schreibt er: Die moderne bildende Kunst und das moderne mächtig emporgeblühte Kunstgewerbe werden in diesen wahren ›Kunstformen der Natur‹ eine reiche Fülle neuer und schöner Motive finden. Das bezieht sich aber auf die einzelnen abgebildeten zoologischen Formen, nicht auf deren Anordnung.
|
||||||||||
Zweiter Fragekomplex: logisches Verhältnis der BildteileDieser Abschnitt präsentiert in unsystematischer Weise unterschiedliche logische Verhältnisse, die durch Bildvielheiten dargestellt werden. Die spezifische Verwendung der Bildvielheit ergibt sich aus dem umgebenden Text, aus der Legende, aus ins Bild integrierten Hilfselementen oder aus der Bildgestaltung selbst. Jedes der hier vorgestellten Beispiele kann selbstverständlich auch mit den Kriterien erfasst werden, die im ersten Fragekomplex erörtert wurden, was hier aber nicht gemacht wird, um den Blick auf das logische Verhältnis der Bildteile zu fokussieren. |
||||||||||
| Zweiter Fragekomplex: logisches Verhältnis der Bildteile Set: Alle Individuen, die das nur durch Aufzählung kulturell definierte Objekt ausmachen, werden abgebildet. Erstes Beispiel: Die sieben Weltwunder.
Zweites Beispiel: Das Alphabet – hier die interessante Variante einer Geheimschrift in Bildern
Typen A (exhaustiv): Die Arten einer Gattung (das ist das Objekt) werden abgebildet. Beispiele:
Hier die fünf Gangarten des Pferdes (Schritt, Trab, Galopp, Karriere, Passgang – mehr gibt es natürlicherweise nicht):
Typen B (offene Reihe) Beispiel: Bartformen. Gezeigt werden (für Europa und dessen Vorgeschichte) repräsentative, benennbare Formen.
Meronymie: Dargestellt werden die verschiedenen Teile in der körperlichen Welt, die zusammen ein Ganzes ausmachen, z.B. die Gliedmaßen des Leibes. Hier wird gerne die Vielheit nicht ganz aufgetrennt dargestellt, sondern – um den Zusammenhang aufzuzeigen – die Teilbilder beieinander. Erstes Beispiel, aus der Biologie. Das Bild zeigt die neunzehn Gliedmaßen (das ist das Holonym) wie 1.Antenne, Mandibel, 1.Maxille usw. (das sind die Meronyme) des männlichen Flusskrebs (Potamobius astacus):
Zweites Beispiel, aus der Technik: Was alles zu einem Bahnhof gehört
Drittes Beispiel, aus der Technik: Töpferscheibe. Gelegentlich werden in den Tafelbänden der »Encyclopédie« technische Geräte in Einzelteilen zerlegt präsentiert, als diente das Bild dem Handwerker dazu, das Gerät nachzubauen. Die Teile sind vielleicht aus Gründen der Platzersparnis so angeordnet. (Anders als im Explosionsbild, wo ihre relative funktionale Nähe dargestellt ist.)
Hyperonymie: Unterschiedliche Ausprägungen (nicht Unterarten) eines Oberbegriffs (Hyperonyms), aus denen die definierenden Merkmale (als Schnittmenge) ersichtlich sind, werden dargestellt. Beispiel: Stuhl
Varianten: Ein naturkundliches Phänomen wird in verschiedenen Varianten gezeigt. Erster Fall: Endliche viele Varianten. Beispiel: Polymorphismus in der Biologie. Man unterscheidet saisonalen Dimorphismus (z.B. Balzgefieder bei Vögeln) und sexuellen Dimorphismus. Bei der Rohrammer (Emberiza schoeniclus) unterscheiden sich Männchen (oben) und Weibchen (unten):
Es gibt auch Tiere, wo dasselbe Individuum zwei ganz verschiedene äußere Formen annehmen kann:
In einem botanischen Werk kann die Pflanze gleichzeitig mit Blüten und Früchten dargestellt werden, obwohl dies in der Natur bei dieser Art nicht vorkommt. Hier hat Conrad Gessner (1516–1565) zum bestehenden Holzschnitt im Pflanzenbuch des Matthioli noch die dazugehörigen Blüten an den Rand gezeichnet (saisonaler Dimorphismus):
Zweiter Fall: Unendlich viele Varianten. Beispiel: Schneekristalle. Wilson A Bentley (1865–1931) fotografierte tausende von Schneeflocken. Es handelt sich nicht um Unterarten (wie bei den Bärenarten der Familie Ursidae). Wegen der unendlichen Vielfalt ist die Auswahl beliebig; die Einzelfälle bleiben unbenannt.
Zustände: das Objekt selbst hat verschiedene Zustände; das Bild zeigt die für das Funktionieren des Objekts wichtigen. Erstes Beispiel: Dreiweghahn
Zweites Beispiel: Ballettpositionen
Ansichten: Die Teilbilder zeigen verschiedene Ansichten desselben Objekts: aus unterschiedlicher Entfernung, aus unterschiedlicher Perspektive, verschiedene Schnitte, mit unterschiedlicher Vergrößerung. • Erstes Beispiel: Dasselbe Portrait aus verschiedenen Winkeln:
• Zweites Beispiel: Dasselbe Objekt aus zwei Himmelsrichtungen Die Bauten der Termiten in Australien sind mit den Breitseiten nach Osten/Westen gewandt; die Schmalseiten weisen nach Norden/Süden. So heizen sich die bauten in der Mittagshitze nicht auf.
• Drittes Beispiel: Totale und Detail Im Bild liegt der Akzent auf dem mikroskopischen Bild der Schuppen. (Die narrative Szene des Fischfangs schließen wir aus der Betrachtung aus.) Thema ist die Speisevorschrift im Buch Leviticus (3.Mos. 11,9): Alle Fische, die Flossen und Schuppen haben, sind zu essen erlaubt. Dazu bildet Scheuchzer eine Sole und dero Schuppen ab (und beschreibt diese auch im Text). Die Seezunge ist im Rahmen unten als ganzer Fisch abgebildet, auf einer aufgerollten Leinwand vor dem Bild-Spiegel zeiget sich die Gestalt der Schuppen, wie sie unter dem Vergrösserungs-Glase zu sehen aus Hook, Micrograph. p. 161. (Beim zitierten Robert Hooke, Micrographia: or, Some physiological descriptions of minute bodies made by magnifying glasses. London 1665, ist gegenüber S. 162, Schem. XXI nur die Vergrößerung zu sehen.)
Drittes Beispiel: Aussen- / Innenansicht
Formvergleich A: die Einzelbilder können willkürlich angeordnet werden Erstes Beispiel: Fußabdrücke, die das Wild bei verschiedenen Gangarten im weichen Boden hinterlässt, heißen beim Hochwild Fährte, beim Niederwild Spur, beim Geflügel Geläuf. Die Fährten- und Spurenkenntnis dient dem Jäger/Förster/Naturfreund, das Vorhandensein einer bestimmten Art von Wild im Revier festzustellen.
Zweites Beispiel: Speise- und Giftpilze werden hier nebeneinander ausgebreitet. Es geht nicht darum, den semantischen Oberbegriff ›Pilz‹ zu erläutern oder Ausprägungen einer biologischen Größe ›Fungi‹ darzulegen, sondern eine Reihe von typischen Ausprägungen vorzuführen. Die Identifikation des dem Benutzer vorliegenden Exemplars mit den Typus kann gelegentlich lebensrettend sein.
Formvergleich B: die verschiedenen Formen stehen in einer Vergleichsreihe Die Allen’sche Regel (nach Joel Asaph Allen 1838–1921) besagt, dass bei Tieren die relative Länge der Körperanhänge (Extremitäten, Schwanz, Ohren) in kalten Klimazonen geringer ist als bei verwandten Arten und Unterarten in wärmeren Gebieten. Die Länge der Ohren nimmt in der Verwandtschaftsreihe von a Eisfuchs – b europ. Fuchs – c Wüstenfuchs zu. Die drei aufgereihten, genau vergleichbaren Portraits verdeutlichen die Regel schlagartig, wenn damit natürlich auch nichts ausgesagt ist über deren Begründung (Verminderung des Wärmeverlusts durch kleinere Oberfläche).
Rangliste: die Einzelbilder stehen in einer graduellen Reihenfolge
Im folgenden Beispiel einer Rangliste sind die Objekte auf den Teilbildern jeweils um Zehnerpotenzen (von oben nach untern betrachtet) kleiner. Der Verkleinerungsmaßstab ist angegeben.
Größenvergleich: Die Größe eines Dinges wird verdeutlicht durch Darstellung eines Vergleichsobjekts, das der Betrachter besser kennt. Bei geographischen Karten kann das Heimatland des Benutzers als Vergleichsgröße dienen; es wird in einem Hilfsbild dargestellt. Im folgenden Beispiel entstammen die miteinander verglichenen Dinge verschiedenen Sphären. (Wie überwältigend hoch der Kölner Dom ist, wird als bekannt vorausgesetzt; Thema ist der Dampfer):
Explosionsbild: Struktureller Bezug zwischen den Teilen Ein komplexes System wird in seine Einzelteile ›zerlegt‹ so abgebildet, dass die Abstände zwischen diesen unter Beibehaltung der relativen Lage vergrößert werden. Hier der Vergaser Weber 40 DCNF/1 des Ferrari 206 GT Dino:
Funktionale Anordnung: Die Teile werden in ihrem praktischen Lebens-Zusammenhang dargestellt.
Kontinuierlicher Formvergleich (›Morphing‹): Die benachbarten Teilbilder unterscheiden sich minim, vom ersten bis zu letzten besteht indessen eine starke Differenz. Anders gesagt: von einen Pol zum andern besteht ein gradueller Unterschied. (Mit Suchrobotern findet man im WWWeb unter dem Stichwort ›Morphing‹ viele Bilder und Filme dazu.) Dem Anatomen Petrus Camper (1722–1789) ging es darum herauszustellen, dass der Mensch die perfekteste Creatur ist – wobei die Anatomie aller Wirbeltiere einheitlich ist. Die Schädel unterscheiden sich im wesentlichen durch den ›Gesichtswinkel‹; wobei die Gerade vom vorderen Zahnansatz im Oberkiefer zum Überaugenwulst besonders bedeutsam ist, die bei primitiven Affen einen Winkel von ca. 45 Grad einnimmt, und beim Menschen senkrecht verläuft. Campers Bildtafeln zeigen den Übergang vom Affen zum Menschen in 16 Bildern. (Auf diesem Scan der ersten der beiden Tafeln sind die Winkel-Linien gut ersichtlich:)
Johann Caspar Lavater (1741–1801) stellt in seinen physiognomischen Studien (und Phantasien) ähnliche Überlegungen an. Er kennt die Arbeit von Camper (die 1791 auf französisch erschien), sagt aber, er habe schon vorher ähnliche Überlegungen angestellt. In der anatomischen Erscheinung möchte er geistige Anlagen erkennen.
Zwei Profiltafeln erläutern das.
Exkurs zur Entstehungsgeschichte:
Wenn Lavater von einer Probe seiner Evolutionstheorie spricht, so darf das nicht als Darwinismus avant la lettre verstanden werden. Im Hintergrund steht der Gedanke einer Stufenleiter der Lebewesen: Im Einleitungsgedicht zur den Animalitätslinien steht S. 103: Alles formt die Natur nach Einem großen Gesetze […]. | Alles, Alles hebt sich empor von Stufe zu Stufe, | Auf , vom bloßen Daseyn zum Leben, vom Leben zum Wollen; | Leicht erkennbar ist jeder Stufe Gepräg, und bestimmbar | Jeder Stufe nöthige Form […]. Lavater kannte das Werk von Charles Bonnet, hat es 1770 teilweise übesetzt. Dort liest man im Zweyten Theil, IX. Hauptstück unter dem Titel Unermeßliche Kette der Dinge (im frz. Text: Immensité de la Chaîne des Etres):
Wieso verwendet Lavater als Ausgangspunkt nicht wie Camper den Affen? Eine Vermutung (von R.Stutz): Die Idee könnte von Ovid-Illustrationen herrühren. Die lykischen Bauern verwehren Latona Wasser zu trinken und werden in Frösche vewandelt. (Metamorphosen VI, 339–381) In den Illustrationen erscheinen die Verwandelten in verschiedenen Varianten: noch ganz als Mensch bis zu schon ganz Frosch.
Grandville (1803–1847) macht sich einen Spaß daraus, vom Menschenantlitz zum Tierkopf hin und her umzuzeichnen; schließlich ist er der Zeichner von »Les Metamorphoses du Jour« (1829) und der Illustrator von »La Vie privée des Animaux« (1840). Schon 1843 erscheinen im im »Magasin pittoresque« zwei solche Verlaufsstudien: L’Homme descend vers la Brute (p.108) und L’Animal s’élève vers l’Homme (p. 109). Dann:
Linley Sambourne (1844–1910) verwendet die Technik, um die Darwinistische Lehre zu karikieren. Hier fällt die Verlaufsreihe nun wirklich zusammen mit der Theorie des damit Karikierten: Regenwürmer als Ausgangspunkt und Darwin als Endpunkt der Evolution. Darwins Buch »The Formation of Vegetable Mould through the Action of Worms« war 1881 erschienen.
Zeitliche Abläufe Vgl. hierzu auch das Kapitel >>> Raum& Zeit Schon früh wurden dynamische Abläufe in Einzelphasen zerlegt und diese abgebildet. Ein Bedürfnis dafür waren die Anleitungen für das Tanzen und Fechtschulen. Es folgen Beispiele aus verschiedenen Wirklichkeitsbereichen. • Technik: Viertaktmotor – Während die Chronofotografie à la Muybridge und Marey ein Verfahren ist, bei dem die Bilder nach einem mechanischen Intervall-Raster erzeugt werden, hat der Visualisierer beim Viertaktmotor markante Phasen herausgegriffen.
• Geschichte: Territorialentwicklung während der Balkankriege In einer Reihe von vier Landkarten werden die territorialen Änderungen im Zeitraum von 1856 bis 1923 dargestellt, wobei jeweils die Gebietsverteilung nach den Friedensschlüssen gezeigt wird: (1) 1856 nach dem Pariser Kongress; (2) 1878 nach dem Berliner Kongress; (3) 1913 nach den Balkankriegen 1912/13; (4) nach dem (ersten) Weltkrieg. – Deutlich wird schlagartig der Rückgang der türkischen Gebiete und das Erstarken der Nationalstaaten, insbesondere die Ausdehnung von ›Serbien‹, das Montenegro inkorporiert.
Quellenangabe: Der Große Herder. Nachschlagewerk für Wissen und Leben. 4. Auflage von Herders Konversationslexikon, Band I (1931) s.v. Balkankriege. • Dendrochronologie. Anders zu verstehen sind die Teilbilder hier. Die Querschnitte durch Bäume stehen in einer chronologischen Abfolge; das Entscheidende ist, dass die Strukturen der schmalen und breiten Jahrringe je in einem Teil-Bereich genau aufeinander passen, so dass sich die Muster überlappen, wodurch sich eine lange Chronologie ergibt. (Die Bilder der Fahrzeuge rechts sind belanglose Zugabe, um die Epoche zu markieren.)
Narrative Abläufe fiktionaler Art werden als Comic strip (französisch: bande dessinée) dargestellt. Hier ein Beispiel aus älterer Zeit: Hans Sachs, »Der Waldbruder mit dem Esel« (6. Mai 1531):
Mehrere Bildsphären: Sebastian Brant lehrt 1494 im »Narrenschiff« (Kap. 32), eine Frau zu beaufsichtigen sei so erfolglos wie Flöhe hüten oder Wasser in einen Brunnen schütten. Der Text enthält ein metaphorisches Element:
Das Bild vereinigt diese beiden Sphären:
Mehr zu dieser Technik im Kapitel >>> Simultane Szenen Alternative (richtig / falsch oder erlaubt / verboten): • Während Aeneas, als Troja brannte, seinen alten Vater Anchises auf dem Rücken und den Sohn an der Hand in Sicherheit führte [Vergil, »Aeneis« II, 707ff.], ließ (siehe die Szene im Hintergrund links) Kaiser überliefert. In d seine Mutter Agrippina nicht nur umbringen, sondern auch noch sezieren, um zu sehen, wo er als Embryo gelegen war.*
• Zweckmäßige Körperhaltung:
Zwei räumliche Ansichten desselben Phänomens Das Bild in der Mitte zeigt die Luftströmungen im Aufriss, ähnlich wie die Isobaren über einer geographischen Karte. Bei den gestrichelten Linien A....A' und B....B' sind Vertikalschnitte angebracht, die in den Bildern oben und unten aufgeklappt gezeigt werden, so dass die Höhenschichtungen sichtbar werden. Gut zu erkennen sind die Orte, wo sich Niederschläge ereignen (mittleres Bild: schraffierte Fläche; diagrammatisch – oberes/unteres Bild als mimetisch dargestellter Regen aus Wolken).
Explanandum und Modell: Modelle dienen dazu, ein wenig bekanntes System (das Explanandum) in vereinfachter Form zu präsentieren. Sie entstammen einer anderen Welt als das Explanandum. Durch die Parallelstellung werden die Analogien (›a funktioniert beim Explanandum ähnlich wie b beim Modell‹) deutlich:
Hilfsbild: Der Karte von Emden im Maßstab 1:55’000 (Hafenanlagen) ist eine kleinere Karte im Maßstab 1:500’000 (Lageplan) beigegeben, die zeigt, wo diese Stadt in der weiteren Umgebung zu lokalisieren ist.
Objekt- / Meta-Ebene:
Superimago und Subimagines:
Gesteigerte Wiederholung analoger Szenen: In (mittelalterlichen bis barocken) christlichen Bildprogrammen stehen Teilbilder mitunter in typologischem Bezug. Die Typologie stellt einen Zusammenhang zwischen zwei zeitlich auseinanderliegenden, aber in der Figuration ähnlichen Ereignissen usw. her, welche durch die entscheidende christliche Zeitenwende, die Inkarnation, getrennt sind. Das Ereignis aus dem Alten Testament gilt als Prophetie des analogen Ereignisses im Neuen Testament; im NT Ereignis wird die AT Verheißung erfüllt.
Vgl. die Website von Aaron Schart (Universität Duisburg-Essen) zur Biblia pauperum {Zugriff 9.12.2018} sowie Hildegard Zimmermann, Armenbibel (Biblia pauperum, Biblia picta), in: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, Bd. I (1936), Sp. 1072–1084. > http://www.rdklabor.de/w/?oldid=89657 |
||||||||||
Dritter Fragekomplex: Kognitiver Mehrwert konkreter Fälle von BildvielheitDie Frage ist: Was leistet die Zusammenstellung von Einzelbildern in einer der genannten Gestalten mehr als die Präsentation der einzelnen Bilder, wenn sie etwa in einem Buch verstreut vorkämen? Welche Vorteile hat die eine oder andere Präsentationstechnik? ••• Eine Zusammengehörigkeit wird evoziert.
••• Ähnlichkeit wird erkennbar
••• Feine Unterschiede werden erkennbar. Zwecks besserer Vergleichbarkeit werden 4 Arten von Kartenprojektion in den vier Quadranten derselben projizierten Erdkugel dargestellt. Man erkennt am Äquator, wo die Verschiedenheiten bezüglich Längenkreisen liegen; am Nullmeridian erkennt man die Verschiedenheiten bezüglich Breitenkreis. (Bsp.: Der 45-Grad-Breitenkreis liegt bei der flächentreuen Projektion II höher, deshalb erscheint dort Grönland nicht so groß wie Afrika.)
In der Kunstgeschichte ist der Vergleich von stilistisch verschiedenen Bildern vergleichbaren Inhalts methodisch verfolgt worden von Heinrich Wölfflin [1864–1945], Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. (1915), 5. Auflage München: Bruckmann 1921 Hier ein stilgeschichtlicher Vergleich von vier ähnlichen Ornamenten (Frührenaissance — Barock — Rokoko — Klassizismus):
••• Unterschiedliche Formationen eines Komplexes werden erkennbar. Pierre Belon (1517–1564) beobachtete als erster Ähnlichkeiten im Grundbauplan (Homologie) des Skeletts der Wirbeltiere. In seinem Werk L’histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions, & naïfs portraicts retirez du naturel: escrite en sept livres, 1555 stellt er das Skelett eines Menschen demjenigen eines Vogels gegenüber : L’anatomie des ossements des oyseaux, conferee auec celle des animaux terrestres, & de l’homme. (Livre I, Chap. XII) Digitalisat: http://www.e-rara.ch/nev_r/content/pageview/1893505 (und die nächste Seite)
••• Größenordnungen werden erkennbar.
••• Der funktionale Zusammenhang kann ausgeblendet oder erkennbar gemacht werden. Im Bild aus dem Bilderduden sind die Instrumente freigestellt und als Bildhaufen präsentiert; die Streichinstrumente sind perspektivisch dargestellt und einige Detailansichten sind beigegeben. In Knaurs Lexikon sind sie so angeordnet, wie sie im Konzertsaal placiert sind; das bedingt, dass die Streichinstrumente nur in Frontalansicht gezeigt werden können.
|
||||||||||
Online seit Februar 2016; Updates: 2. Juli 2016; 28. August 2017; 28. Februar 2018; 26. Juli 2018, November 2020 — P.M. |
||||||||||