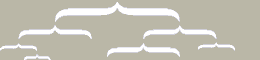
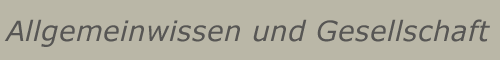
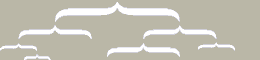 |
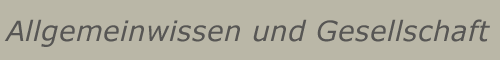 |
Pictogramme und dergleichen |
Pictogramme und ähnliche BildzeichenAls Pictogramme bezeichnen wir vereinfachte graphische Darstellungen, die der visuellen (schriftlosen) Kommunikation dienen. (Wortfeld: Bildschriftzeichen, Infografik, Signaletik). Moderne Varianten sind die Emoticons. Zur Einstimmung: https://de.wikipedia.org/wiki/Unicodeblock_Verschiedene_Symbole Inhaltsübersicht Einleitung
Fallstudien |
||||||||||||
Einleitung {1} Bezüge zwischen Signifiant und SignifiéSiginfiant = das Bedeutende, das (materielle) Mittel, mit dem etwas (Geistiges) evoziert und eine Funktion erbracht wird. | Signifié = das damit Bedeutete, diese Funktion. Beide zusammen machen ›das Zeichen‹ aus. Grundsätzlich gibt es zwei Typen. (Mehr dazu unter {4}). Die Terminologie ist variabel:
In unserem Projekt bevorzugen wir die Begriffe mimetisch vs. diagrammatisch. (Der von Charles S. Peirce eingeführte Begriff symbol ist im Deutschen etwas irreführend.) Eine junge diagrammatische Technik bildet das Durchstreichen, um ein Verbot zu signalisieren; hier: ›Nicht im Hausmüll entsorgen!‹: In ein und demselben Pictogramm werden oft beide Arten nebeneinander verwendet. *) Charles S. Peirce, Phänomen und Logik der Zeichen, hg. und übers. von Helmut Pape, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1983 (stw 425). |
||||||||||||
Einleitung {2} StilisierungBei den mimetischen Zeichen gibt es verschiedene Grade von Stilisierung. Das wird deutlich, wenn man die Geschichte einzelner Pictogramme betrachtet, wie in diesem Beispiel:
|
||||||||||||
Einleitung {3} Historische ÜberbleibselManche Pictogramme halten sich, obwohl es die im Bild stilisiert dargestellte Sache gar nicht mehr gibt. Das Logo der deutschen wie der österreichischen Post zeigt (2015) ein Posthorn; dieses Gerät ist doch wohl schon länger außer Gebrauch. Das Diskettensymbol auf der klicksensitiven Bildschirmregion für das Abspeichern – Apple baut seit 1998 Computer ohne Diskettenlaufwerk; Sony stellt seit 2011 keine Disketten mehr her; junge an USB-Sticks als Speichermedium gewohnte Benutzer wissen nicht mehr, was eine Diskette war. Dennoch ist das Pictogramm in den Menüleisten für die Funktion speichern allgegenwärtig.
(Beim Papierkorb handelt es sich um eine Metapher aus dem Feld des Schreibtisches; hierzu gehören auch die Folders mit dem Aussehen älterer Registrierkarten in Karteikästen und vielleicht die Sanduhr.) Die Wagenrücklauftaste (carriage return, kurz CR, U+23CE = ⏎) war bei den elektrischen Schreibmaschinen die Taste, deren Betätigung den Wagen mit dem eingespannten Papier oder den IBM-Kugelkopf mechanisch zurückbewegte; das gibt es bei Computern nicht mehr, aber das Pictogramm ist geblieben, obwohl die Taste auch andere Funktionen (ENTER) hat.
Damit wird nicht auf ein Museum für antike Lokomotiven hingewiesen, sondern es ist das Gefahrsignal für ›Bahnübergang ohne Schranken‹:
Eine Frauengestalt mit einem Rock – obwohl in unseren Breiten die meisten Damen Hosen tragen – zeigt, wo die Damentoilette ist. Andere Pictogramme sind wohl für junge Leute heutzutage kaum mehr verständlich (eine Wählscheibe für Telefon). |
||||||||||||
Einleitung {4} Andere Bezüge zwischen Signifiant und Signifié{4a} In der Tabelle unter {1} haben wir den dritten Grundtyp von Peirce nicht aufgeführt: index. Hier beruht der Bezug auf einem Kausalitätsverhältnis; das Signifiant ist ein Symptom des Signifiés. Klassisches Beispiel ist das Emoticon (mehr dazu unten) smiley, in dem der (stilisierte) Gesichtsausdruck das Signifiant für das Signifié: ›darüber freue ich mich‹ oder ähnlich abgibt:
Ähnlich funktionieren womöglich Schreckfarben (blutrot für Verbot bei den Verkehrssignalen; gelb-schwarz gestreift wie bei den Wespen). {4b} Der Bezug kann auch auf einer metaphorischen Brücke beruhen. – Metapher: Der Vergleich ist aus einem anderen Sinnbezirk genommen, hat aber mit dem Gemeinten eine Reihe von gemeinsamen Zügen. Beispiel: Das Pictogramm verweist auf eine Rubrik zum Thema ›Hier findest Du noch mehr Ideen‹; als Emoticon ›Mir ist ein Licht aufgegangen‹. Vgl. > http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/IdeaBulb (März 2018)
{4c} Der Bezug kann auf einer Metonymie beruhen. – Metonymie: ›Umbenennung‹, Ersatz einer Vorstellung, durch eine andere, die zu zur Gemeinten in einer realen (logischen, ursächlichen usw.) Beziehung steht. Beispiele: der Autor für sein Werk (Homer lesen); das Besondere für etwas Allgemeines (wir müssen unser Brot verdienen); Rohstoff für das daraus Erzeugte (jemandem das Eisen in den Leib stoßen) usw. Beispiel 1: Im Lexikon (siehe unten) ist für den Hinweis ›Dieser Artikel behandelt ein Gebiet aus der Astronomie‹ ein Komet abgebildet, d.h. also ein Teilphänomen des ganzen Gebiets. Beispiel 2: Für ›Achtung Gefahr‹ steht ein Totenkopf. Dieser als Teil eines ganzen Leichnams; und dieser als Folge für die Ursache.
{4d} Der Bezug kann auf einem eingebürgerten wissenschaftlichen Modell beruhen (vgl. das Unterkapitel zu den Modellen). Beispiel: Seit 1920 wird das auf Rutherford zurückgehende Planetenmodell für das Atom graphisch realisiert.
Die Zeichnung wird dann als Pictogramm weiterverwendet, z.B. um vor radioaktiven Substanzen zu warnen.
Auf dem Cover der Ausgabe für Mädchen des Pestalozzikalenders 1961 ist ein Portrait von Marie Curie zusammen mit diesem Pictogramm abgebildet. Der Text S.7f. erwähnt, dass sie 1911 ihren zweiten Nobelpreis erhielt; damit wird also das 50-jährige Jubiläum gefeiert. Das Atommodell erinnert hier daran, dass die Frau den Atomkernzerfall erforscht hat. |
||||||||||||
Einleitung {5} Abhängigkeit vom kulturellen UmfeldEs versteht sich, dass die diagrammatischen Zeichen auf einer Instruktion beruhen. Aber auch die mimetischen sind nicht allgemein verständlich. Ein Marsmensch, der seine Nahrung zuhause mit einem Trinkhalm aufnimmt, wird bei einem Besuch auf der Erde die Mensa der Universität nicht finden, die so ausgeschildert ist:
|
||||||||||||
Einleitung {6} FunktionenGrundsätzlich ist an die linguistische Sprechakttheorie anzuknüpfen: John L. Austin, Zur Theorie der Sprechakte, dt. Bearbeitung von Eike von Savigny, (RUB 9396–98), Stuttgart 1972 (engl. How to Do Things with Words, Cambridge/Mass. 1962). Ein Sprechakt enthält als Komponenten: den ›propositionalen Gehalt‹ und die ›illokutive Funktion‹. Anhand der Verkehrssignale lässt sich das simplifiziert veranschaulichen: Im Beispiel wird der prop. Gehalt ›Es herrscht Gegenverkehr‹ durch die beiden Pfeile repräsentiert — die illok. Funktion durch die Form des Signals: Ich muss dem Gegenverkehr Vortritt lassen / Vorsicht: es folgt eine Strecke mit Gegenverkehr / Ich habe Vortritt vor dem Gegenverkehr
Die illokutive Funktion wird • einerseits durch den Kontext deutlich (an einem Flughafen ist ein Hinweis auf die Zollabfertigung zu erwarten; in einem Lexikon der Hinweis auf die Disziplin, zu der der Artikel gehört; u.a.m.); • anderseits durch geeignete Mittel expliziert:
Beispiele: • Mimetische Pictogramme wollen keine Aussage über das Aussehen des Dargestellten machen, sondern sie evozieren das Dargestellte, um beispielsweise auszudrücken (illok. Funktion):
• Diagrammatische Pictogramme:
—————— Pictogramme (und verwandte graphische Mittel) sind – abgesehen von ihrer Gestalt (Stilisierung u.a.) – dadurch definiert, dass sie solche Funktionen haben wie:
Sie wollen nicht solche Funktionen erfüllen wie beispielsweise:
In didaktischen Werken können Pictogramme eine Rolle spielen, um an Dinge zu erinnern (mnemotechnische Funktion), die bereits eingeführt sind, aber nicht, um die Funktionsweise eines Dings zu erklären. Beispiele:
|
||||||||||||
Fallstudien, geordnet nach Sachgebieten
|
||||||||||||
SchreibsystemePictogramme im engeren Sinn verweisen sprach-unabhängig auf eine Klasse von Objekten; Beispiel aus einem Hilfsmittel für »Global Communication at Fingertips«, das Reisenden helfen soll, sich ohne Sprachkenntnisse zu verständigen:
Ideogramme dagegen verweisen auf ein Wort. Beispiele: $ für Dollar, € für Euro, ‰ für Promille, ® für eingetragene Warenmarke, Ω für elektrischen Widerstand. Wie die Ideogramme funktionieren Flaggenzeichen und Signalcodes von Schiffen. Sie sind rein konventionell. Wichtig ist hier einzig, dass die Flaggen eindeutig unterscheidbar sind.
Die Welt von A bis Z. Ein Lexikon für die Jugend, für Schule und Haus, hg. von Richard Bamberger, Fritz Brunner; Heinrich Lades, Wien: Verlag für Jugend und Volk 1953, s.v. Flaggenzeichen, S. 177. Ein anderer Code steht auf > https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Semaphore_Signals_A-Z.jpg Zur Instruktion verwendeten Armee und Marine der USA eine Volvelle:
> http://addiator.blogspot.com/2008/02/volvelles-wheel-charts-and-slide-charts.html {April 2018} Hieroglyphen: Die ägyptische Schrift enthält drei Arten von Zeichen: Wortzeichen, Lautzeichen und stumme Deutezeichen. Die Wortzeichen (Ideogramme) geben den Begriff des sichtbaren Gegenstandes oder einer sinnlich wahrnehmbaren Handlung wieder, ohne Rücksicht auf die Aussprache. Man schrieb also das Wort ›Pflug‹, indem man einen Pflug zeichnete; das Wort ›gehen‹, indem man ein Zeichen schrieb, das schreitende Beine zeigt (hier liegt ein assoziativer, metonymischer Zusammenhang vor); das Wort ›schädigen‹, indem man ein Bein zeichnete, das von einem Messer durchbohrt ist. Diese Zeichen sind stilisierte Umrisszeichnungen des Sichtbaren, gerade so naturgetreu, dass man das Gemeinte erkennt:
Die Nummern sind die von Gardiners Liste: http://en.wikipedia.org/wiki/Gardiner's_sign_list In unserem Zusammenhang nicht relevant: Es gibt selbstverständlich viele Wörter, die sich nicht mit Ideogrammen schreiben lassen, z.B. ›Sohn‹, ›groß‹, Schönheit‹ usw. Dafür verwendeten die Ägypter Homonyme, ähnlich wie wir es in einem Rebus tun.
Gaunerzinken
Aus: Günther Puchner, Kundenschall das Gekasper der Kirschenpflücker im Winter, München: Heimeran 1974, S. 26. Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Zinken_%28Geheimzeichen%29 |
||||||||||||
RebusBeim Rebus (rebus ist der lat. Ablativ Plural von res = ›Ding‹, also: ›mittels Dingen‹ sprechen / schreiben) verweisen die Bilder nicht auf das normalerweise mit ihnen gemeinte Ding (also das Bild eines Wagens nicht auf einen Wagen), sondern auf die phonetische oder graphematische Repräsentation des gemeinten Dinges. (Deshalb funktionieren diese Rätsel auch nur in einer bestimmten Sprache.)
Gallus Kemly Zentralbibliothek Zürich, Hs C101, fol. 98r (um 1450/53) ich rât (Rad) dir: hüet (Hut) dich, brech? (Krug) ich, stech (Distel) ich, snîd (Sichel) ich. Ich rech (Rechen) mich mitt d’ hand (Hand), dz sag (Säge) ich dir, mitt dem swert (Schwert) vor wâr under zît. (nach Eva-Maria Schenck Nr. 101) Literatur: Eva-Maria Schenck, Das Bilderrätsel, Hildesheim: Olms 1973. Jean Céard / Jean-Claude Margolin, Rébus de la Renaissance, Paris: Maisonneuve et Larose 1986. Eugen Oker, Bilderrätsel. Rund um den Rebus. Beispiele, Anleitungen, Auflösungen, München: Hugendubel 1994. |
||||||||||||
KalenderIn Kalendern wurden einst Zeichen für die Sternzeichen wie z.B. ♈ ♋ ♎ ♐ ♒ gesetzt, sowie solche für die Monatsarbeiten oder was für Tätigkeiten zur bestimmten Zeit ±günstig sind (z.B.Haare schneiden ✄), die Feste des Kirchenjahrs oder ob der Mond obsigend ☊ oder ☋ nidsigend ist. Beispiel: https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0010/bsb00106565/images/ Hier ein Beispiel aus der germanischen Kultur:
S. W. Partington, The Danes in Lancashire and Yorkshire, London 1909; mit Erklärung der Pictogramme https://archive.org/details/danesinlancashir00partrich/page/144/mode/2uphttps://www.gutenberg.org/files/43910/43910-h/43910-h.htm#ip_144 Der altgläubig gebliebene Thomas Murner (1475–1537) verfasste 1527 in Luzern ein Pamphlet gegen die Protestanten: Der Lutherischen Evangelischen Kirchen Dieb und Ketzer Kalender, in dem er solche Pictogramme karikiert und auf Verfehlungen des anderen Lagers bezieht.
Hier ein Ausschnitt aus einer früh darauf hinweisenden Publikation: Das Kloster, weltlich und geistlich. Meist aus der ältern deutschen Volks-, Wunder-, Curiositäten- und vorzugsweise komischen Literatur. Zur Kultur- und Sittengeschichte in Wort und Bild, von J. Scheible, Zehnter Band, Stuttgart: Verlag des Herausgebers 1848, S. 201–215. |
||||||||||||
BeschauzeichenBeschauzeichen im spätmittelalterlichen Tuchhandel, die den Hersteller benennen und ein Gütesiegel der Zunft darstellen, scheinen rein auf Konvention zu beruhen. Denkbar sind freilich gelegentliche Motivierungen der Zeichen wie z.B. dass der Weber namens Krum eine Kurve in sein Beschauzeichen setzt oder der namens Lengihager einen langen Zaun (schweizerdeutsch ›Hag‹).
Hans Conrad Peyer, Leinwandgewerbe und Fernhandel der Stadt St.Gallen von den Anfängen bis 1520, St.Gallen 1959/1960; Band II, S. 37.
Holzschnitt von Christoph Murer (1558–1614) in: Novae sacrorum bibliorum figurae, mit latinischen und teutschen Versen aussgelegt / durch M. Samuelem Glonerum poetam laureatum, Strassburg: getruckt bey Christoff von der Heyden 1625.
Scheibenriss von Daniel Lindtmayder d.J., (1582), Ausschnitt aus dem Bild, gezeigt an der Ausstellung »Ins Licht gezeichnet«, Zentralbibliothek Zürich 2022. Vgl. ferner: Steinmetzzeichen > http://www.steinmetzzeichen.de/start.html (März 2018) Die Signete der frühen Buchdrucker sehen ähnlich aus, hier das von Johannes Grüninger in Straßburg:
Boetius de Philosophico consolatu siue de consolatione philosophiae: cum figuris ornatissimis nouiter expolitus, Argentinae: Grüninger 1501. Zur leicht wiedererkennbaren Präsentation (Corporate Design, Erscheinungsbild) von Firmen wurden im Laufe des 20.Jhs. diverse Pictogramme entwickelt. Oft sind es stilisiert gezeichnete Dingsymbole, wie hier die drei Schlüssel beim Signet für den »Schweizerischen Bankverein«, 1937 gezeichnet von Warja Lavater (1913–2007):
Quelle > http://en.wikipedia.org/wiki/Warja_Lavater |
||||||||||||
Flaggen und FahnenDie Heraldik und Vexillologie kennen stark stilisierte Zeichen, die als Ausweis staatlicher, ständischer oder religiöser Identität, Würde, Macht verwendet werden. Perspektive und Relief sind verpönt. Die Vereinfachung dient natürlich auch der guten Sichtbarkeit; nach einer alten Regel soll ein Wappen oder eine Fahne auf 200 Schritt erkennbar sein.
Johann Caspar Scheuchzer (1702–1729): The History of Japan: giving an account of the ancient and present state and government of that empire; of its temples, palaces, castles and other buildings; Of Its Metals, Minerals, Trees, Plants, Animals, Birds and Fishes […] Written in High-Dutch by Engelbertus Kaempfer …, London 1727. Tafel XXX: Ichnographia Urbis JEDO – Insignia varia, qualia coram principibus & Magnatibus Imperii Japonici gestari solent. Tafel XXX besser ausgefaltet: |
||||||||||||
GradabzeichenTruppengattungen sowie Funktionen sind mit ›sprechenden‹ Pictogrammen bezeichnet, zum Beispiel eine explodierende Kugel für die Artillerie; der Äskulapstab für Sanitätstruppen; ein Schneekristall für Wetterspezialisten. Die Abzeichen der Dienstgrade dienen der schnellen Information über die Hierarchiestufe des Armee- oder Polizei- usw.-Angehörigen. Die Dienstgrade der Offiziere (beispielsweise in der Schweizer Armee vor 2003) sind durch die Dicke und die Anzahl der Streifen bezeichnet: Leutnant – ein dünner (goldener) Streifen am Hut; Major – ein dicker Streifen; Oberst – drei dicke Streifen. Bei höheren Offizieren (Brigadier entsprechend einem Einsterne-General) kommen Kränzchen zur Anwendung, wiederum in entsprechender Anzahl. Hier also ist ein mimetischer Rest bewahrt, die Erinnerung an den Siegerkranz.
Der Große Herder. Nachschlagewerk für Wissen und Leben. 4. Auflage von Herders Konversationslexikon. Band 10, Spalte 1362; Freiburg/Br. 1935: Dienstgradabzeichen im Bundesheer der Schweiz. [Ausschnitt] |
||||||||||||
ElektrotechnikAnhand der Funktionsschaltbilder in der Elektrotechnik lässt sich gut verfolgen, wie nachbildende Visualisierungen vereinfacht werden und auch alte Motivierungen vergessen gehen; vom ›icon‹ zum ›symbol‹. 1935 wurden gewisse Elemente im Schaltschema eines Radiogeräts noch mimetisch abgebildet; einzig die Batterie ist schon stilisiert (rechts: kurze dicke Striche wechseln mit längern dünnen ab):
Der Große Herder. Nachschlagewerk für Wissen und Leben. 4. Auflage von Herders Konversationslexikon. Band 10, Spalte 377; Freiburg/Br. 1935: Rückkopplung. 1938 sind zusätzlich die Röhre und der Kondensator stilisiert:
Der Volks-Brockhaus. Deutsches Sach- und Sprachwörterbuch für Schule und Haus. 9., verbesserte Auflage, Leipzig 1941 [© 1938, in 1 Bd.]; Tafel Rundfunk (gegenüber S.529): Schema einer einfachen Audionschaltung mit induktiver Kopplung Das Pictogramm für die Batterie geht zurück auf den Aufbau der Volta’schen Säule: Otto Spamer’s Illustrirtes Konversations-Lexikon für das Volk, Band 8, Leipzig: Spamer 1880, s.v. Volta’sche Säule (S.794). Ein von Volta im J. 1800 konstruirter Apparat […] Sie besteht aus einer säulenförmigen Übereinanderschichtung von galvanischen Elementen, welche in der Form von Plattenpaaren (Kupfer u. Zink) durch angesäuerte Tuch- od. Pappscheiben von einander getrennt sind. […] Das Bild des Transformators im Schaltschema 1935 wie 1938 links zeigt schematisch die beiden verschieden gewickelten Spulen, die durch einen Eisenkern verbunden sind. (Der Pfeil bedeutet, dass es sich um einen veränderbaren Trafo handelt. Er kann seine Herkunft vom Drehknopf, wo er aufgemalt ist, kaum verleugnen.)
Kleine Enzyklopädie Natur, (Hauptredaktion Gerhard Niese), Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1961, S. 223. Mit dem Aufkommen der integrierten Schaltkreise ändert sich das: Der TAA 151 wird nur noch als dreieckiges Kästchen mit numerierten Anschlüssen wiedergegeben (konventionelles Zeichen):
Pestalozzikalender 1978; Schatzkästlein S.39: Niederfrequenzverstärker mit integriertem Schaltkreis TAA 151 … sein Äußeres sieht in Wirklichkeit anders aus (und das Innenleben ist auf diesem Bild nicht einmal sichtbar):
|
||||||||||||
VerkehrssignaleBei den Verkehrssignalen erkennt man gut den Mix aus Pictogrammen und konventionellen Zeichen:
Der Große Herder, 4. Auflage, 12. Band (1935). Die älteren Schilder waren rein diagrammatisch aufgrund der Anzahl Punkte unterschieden; in den Tafeln zuoberst standen Texte. Die 1934 eingeführten Schilder haben folgende Eigenschaften: Mittels der geometrischen Grundfigur und Farben wird die illokutive Funktion unterschieden. (Das System wird allerdings nicht exakt durchgehalten.)
Der propositionale Gehalt wird auf verschiedene Weise kenntlich gemacht:
2024 sind wir endlich so weit:
|
||||||||||||
LexikaPictogramme in Lexika dienen der Orientierungserleichterung (vgl. Signaletik). In der »Encyclopédie« ist nach den Stichwörtern der Artikel in Kursivschrift jeweils die Disziplin angegeben, in welcher das Wissenselement einzuordnen ist. Die Methode dient zur Trennung von Homonymen, und man weiß sofort, ob man weiterlesen will und in welchem Feld man sich bewegen wird. Dazu kommt, dass die Herausgeber der »Encyclopédie« beweisen wollten, dass jeder Artikel seinen Ort im System der Wissenschaften hat, das Jean LeRond D’ALEMBERT im »Système figuré des Connoissances Humaines« (Band 1, 1751) dargelegt hatte. Beispiele:
Spätere Enzyklopädien (im deutschen Sprachbereich: Hübner, Krünitz, Brockhaus, Meyer, Pierer, Herder, Spamer) kennen das nicht. Ein Beleg für erneute Verwendung findet sich im einbändigen Brockhaus 1926, wo das Verfahren trivialisiert und mit Pictogrammen realisiert erscheint.
Der kleine Brockhaus. Handbuch des Wissens in einem Band, Leipzig 1926, S. 803 Bemerkungen zur Benutzung. Eine Technik für die Bezeichnung der Wissensgebiete mittels solcher Pictogramme ist Synekdoche + Stilisierung, d.h. es wird ein typisches Element herausgepickt und dieses vereinfacht gezeichnet:
Auch hier lässt sich beobachten, dass die Pictogramme aus imitativen Bildern entwickelt wurden, z.B bei der Retorte, die im 18. Jahrhundert so aussah:
Eine andere Technik ist die Übernahme von Attributen mythologischer Wesen oder Personifikationen. (Zuerst steht der Gott / die Personifikation metonymisch für die Disziplin, für die er/sie zuständig ist; dann wird er/sie metonymisch auf ein typisches Attribut reduziert.)
Anregungen für diese Piktogramme mögen die Attribute der Wissenschaften gewesen sein, wie sie auf Frontispizien von Enzyklopädien lange Zeit üblich waren.
|
||||||||||||
MnemotechnikWeil sich Bilder dem Gedächtnis besser einprägen als Texte, versucht die Erinnerungs-Kunst (von der Antike bis in die Barockzeit) diesen Trick: Der Redner / Pfarrer, der seinen Vortrag / seine Predigt auswendig halten muss, prägt sich die einzelnen Punkte anhand einer Reihe von kleinen prägnanten Bildern ein, die er dann anlässlich seines Vortrags vor dem inneren Auge Revue passieren lässt.
Polydorus Vergilius Urbinas, Von den erfyndern der dingen. WIe und durch wölche alle ding / nämlichen alle Künsten / handtwercker / auch all andere händel / Geystliche und Weltliche sachen […] von anfang der Wellt her / biß auff dise unsere zeit geübt und gepraucht […] durch Marcum Tatium Alpinum grüntlich / vnd aufs fleissigst jnns Teutsch transferiret unnd gepracht / mit schönen figuren durchauß gezyeret / jedem Menschen nutzlich und kurtzweylig zuo lesen. Augspurg: Heynrich Steyner MDXXXVII; 2.Buch, 9.Kapitel. |
||||||||||||
KartographieAuf Landkarten werden Pictogramme (›Signaturen‹) verwendet. Hier wird auf das in dieser Gegend erzeugte Produkt hingewiesen (z.B. Schiffe) – dabei ist aber die räumliche Anordnung das Thema, nicht das mit dem Pictogramm Vergegenwärtigte:
Beispiele aus der Schweizerischen Landestopographie:
Eduard Imhof, Thematische Kartographie, Berlin 1972, Abb. 20 (Ausschnitt). Mühle --- Mühlrad Bergwerk --- Hammer und Schlägel gekreuzt chemische Industrie --- primitiver gläserner Kondensations-Kolben Postamt --- Posthorn (was heutzutage nicht mehr so intensiv benutzt wird!) Weizen-Anbau --- Ähre Schlachtfeld --- zwei gekreuzte Säbel Interessant ist die Herkunft der Signatur für "abgelegener Gasthof": ein liegendes Rechteck, an dessen rechter oberen Ecke eine Art Wimpel schräg noch oben ragt. Die Vorstellung lässt sich wohl aus dem ursprünglich mittelalterlichen Brauch herleiten, wo ein ausgesteckter Kranz zeigt, dass dieser Wirt das von der Stadt verbürgte Recht hat, Wein auszuschenken.
|
||||||||||||
ChemieIn der Alchemie wurden die Sterne den Metallen zugeordnet. Für die Planeten war in der Astronomie / Astrologie ein Pictogramm gebräuchlich, das in der Alchemie dann auch für die Metalle verwendet wurde. (Die Zuordnung der sieben Planeten zu den sieben Metallen kennt schon Kelsos, 2. Jh. u. Z.; vgl. Origenes c.Cels VI,22).
Es sind aber weitaus mehr solcher Zeichen für Stoffe und Prozesse verwendet worden, wie Figura zeigt:
Deliciæ Physico-Mathematicæ. Der Mathematischen und philosophischen Erquickstunden Zweyter Theil/ […] zusammen getragen durch Georg Philip Harsdörffern … Nürnberg: Dümler 1661. S. 566f. Es kann hier nicht darum gehen zu erklären, wie John Dalton (1766–1844) das erste wissenschaftlich fundierte Atommodell konstruierte. Im Gegensatz zu den Zeichen der Alchemisten, die eine offene Liste von Stoffen bezeichneten, beziehen sich Daltons Zeichen auf das Atom; es handelt sich nicht um einfache Abkürzungen, sondern die Zeichen haben einen theoretischen Hintergrund. Dalton unterschied erstmals zwischen Elementen und Verbindungen. Für jedes damals bekannte Element führte er ein bestimmtes Kreissymbol ein, die Verbindungen beschrieb er durch eine Aneinanderreihung der entsprechenden Elementsymbole. Das war eine völlig neue chemische Zeichensprache: ein Set von wenigen, syntaktisch nach Regeln kombinierbaren Zeichen.
John Dalton, A New System of Chemical Philosophy, Manchester 1808 – plate 4 and page 218 http://www.archive.org/details/newsystemofchemi01daltuoft http://books.google.de/books?id=Wp7QAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false |
||||||||||||
Populäre WissenschaftsliteraturThema: Kleben. Die zerbrochene Tasse wird mimetisch abgebildet. Die beiden Seiten der Klebstoffteilchen werden dagegen nicht mimetisch wiedergegeben, das wäre bei Beibehaltung des Maßstabs sowieso unmöglich und außerdem undidaktisch, sondern als diagrammatisches Pictogramm. Die an den Werkstoff anhaftende Seite (zur Adhäsion geeignet) wird mit einer ›klebrigen‹ Seite einer Kugel dargestellt; die an den Leim anhaftende Seite (zur Kohäsion geeignet) als Pfeil, der auf der gegenüberliegenden Seite in die entsprechenden Pfeile eingreift:
Wie funktioniert das? Meyers erklärte Technik Band 1, Mannheim/Zürich: B.I. 1963, S. 50f. Thema: Immunabwehr. Die molekulare Struktur der Proteine mimetisch abzubilden wäre nicht nur zu kompliziert, sondern würde auch (dem Laien) den Blick verstellen. Gezeigt werden soll hier, dass die Gestalt der Zelloberfläche genau passen muss, damit die Immunabwehr funktioniert. Dazu genügt eine stark stilisierte Form oder sogar eine erfundene:
Jean Lindemann, Artikel »Eine Wende in der Immunologie. Zum Nobelpreis für Medizin«, in: NZZ, 13. November 1986, S. 65. |
||||||||||||
SignaletikSeit sich die Arbeiten von Otto Neurath und Gerd Arntz durchgesetzt hatten, entwickelte sich die Praxis, Leute in unübersichtlichen Umgebungen (öffentliche Gebäude, insbes. Bahnhöfe und Flugplätze; aber auch in didaktischen Büchern) mittels Pictogrammen zu orientieren. Vgl. ISOTYPE. Angestrebt wird eine schnelle und eindeutige Verständlichkeit. Die Graphiker müssen bei der Vereinfachung (Stilisierung) die Gesetze der Sinneswahrnehmung, aber auch die kulturelle Einübung der Benutzer bedenken. Dabei sind folgende Teil-Techniken am Werk:
Graphisch hervorragend (durch ihre Schlichtheit, Eindeutigkeit und Ästhetik) sind die Pictogramme von Otl Aicher (1922–1991) zur Münchener Olympiade 1972:
(Die Bitte um ©opyright bei info@design20.eu blieb 20215 leider unbeantwortet. Qui tacet, consentire videtur.) Neurath hat sogar trickfilm-ähnliche Gebrauchsanweisungen entwickelt, z.B. hier:
Aus: Otto Neurath, Internationale Bildsprache, 1936. Wie soll man dieses Textilstück waschen? |
||||||||||||
EmoticonsDie älteren Emoticons (von engl. emotion + icon) kamen so zustande:
Mit der SMS-Technik waren diese Emoticons sehr beliebt, weil sie auf dem Bildschirm, der nur Buchstaben zeigen konnte, darstellbar waren. Seit (ab etwa 2007) die Smartphones aufkamen mit Bildschirmen, auf denen man wirkliche Bilder darstellen kann, kommen Pictogramme aller Art für Gesichter (auch von Tieren!), Gegenstände, Aktivitäten u.a.m. in Umlauf.
Literaturhinweis: Martin Städeli: Freispruch auf Bewährung. Der Fall der Emoticons, in: Unmitte(i)lbarkeit. Gestaltungen und Lesbarkeit von Emotionen, Zürich: Pano-Verlag 2005, S. 491–502; vgl. http://www.symbolforschung.ch/node/28#staedeli |
||||||||||||
Weiterentwicklungen✖ Gerald Herbert Holtom (1914–1985) entwarf auf der Basis des Winkeralphabets das Logo ☮ für die Campaign for Nuclear Disarmament. (Der Kreis steht für die gesamte Erde oder nach anderen für die noch Ungeborenen.)
✖ Juli Gudehus (* 1968) hat die biblische Genesis 1993 mittels Pictogrammen dargestellt: Und Gott schied das Licht von der Finsternis …
Das geniale Buch (Bild aus der Leseprobe des Verlags) kann man hier bestellen > http://www.patmos.de/genesis-p-8789.html (Zugriff März 2018, geht noch 2023) ✖ Das erinnert ein bisschen an die »Hypnerotomachia Poliphili« (1499) des Francesco Colonna (1433–1527):
Der Text zu den Pictogrammen: Hypnerotomachia Poliphili; übersetzt und kommentiert von Thomas Reiser, Wunsiedel, OT Breitenbrunn: Th. Reiser 2014; S. 62. Ludwig Volkmann, Bilderschriften der Renaissance. Hieroglyphik und Emblematik in ihren Beziehungen und Fortwirkungen, Leipzig: Hiersemann 1923; S. 15ff. Digitalisat der HAB WoBü > http://diglib.hab.de/inkunabeln/13-1-eth-2f/start.htm?image=00045 ✖ Lukas, Ueli und Andreas Frei haben 2011 das Spiel »Icon-Poet« kreiert. 36 Würfel enthalten 216 Pictogramme. Aufgrund von fünf mittels Würfeln zufällig ausgewählten Pictogrammen und einer Textaufgabe soll (innerhalb von drei Minuten in der Spielfassung) – eine witzige Geschichte kreiert werden. Das Spiel ist erschienen im Verlag Hermann Schmidt, Mainz, und wird in der Schweiz vertrieben durch die Firma Gebrüder Frei. – Bei NZZ-Folio gab es bis 2016 jeden Monat einen Wettbewerb dazu.
Beispiel: Es lebe hoch! Die Tochter heiratet. Drei Toasts auf das neuvermählte junge Paar |
||||||||||||
HinweiseIn diesem Projekt das Kapitel über Otto Neurath Isotype von Gerd Arntz > http://www.gerdarntz.org/isotype Rudolf Modley, Handbook of Pictorial Symbols, 1976. Otl Aicher / Martin Krampen (1977): Zeichensysteme der visuellen Kommunikation, [Berlin]: Ernst 1996. |
||||||||||||
|
Online zuerst März 2015, überarbeitet im Mai 2018 und Dezember 2023 --- pm |
||||||||||||