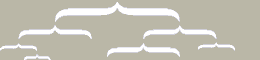
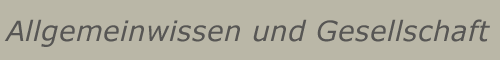
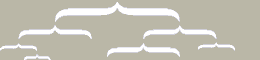 |
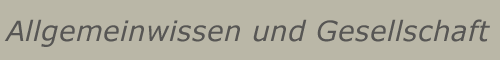 |
Homonyme und synonyme Bilder |
Ähnlichkeit von Bildern ist trügerisch.Es gibt Graphiken, die sich äusserlich ähneln, aber ganz verschiedene Objekte visualisieren; es gibt Graphiken, die dasselbe Objekt ganz verschieden visuell realisieren. In der Linguistik unterscheidet man: Homonymie: Ein Wort mit einer bestimmten lautlichen Struktur (gelb) hat verschiedene Bedeutungen (rosa). Zur Identifizierung der Bedeutung hilft der Kontext. Synonymie: Verschiedene Wörter haben verschiedene lautliche Strukturen (gelb), aber dieselbe Bedeutung (rosa). Die linguistische Terminologie wird hier verwendet. ————————————— Man könnte – wenn das nicht verwirrt – an die Begriffe ›analog‹ und ›homolog‹ in der Biologie erinnern. Analogie: Es gibt morphologische Übereinstimmungen bei Lebewesen mit evolutionär verschiedener Herkunft. (Nach Auffassung der Biologen führen gleiche Selektionsbedingungen zu einer Konvergenz.)
Homolog nennt man Organe, die phylogenetisch denselben Bauplan haben, obwohl sie – bedingt durch ihre Funktion – äusserlich ganz verschieden aussehen.
Beispiele für Homonymie folgen gleich Beispiele für Synonymie unten ⬇ Ein Beispiel für ein ähnlich aussehendes Bildmotiv mit verschiedenen Bedeutungen hier ⬇ |
||
Erstes Beispiel für ›Homonymie‹Das Bild rechts ist eine Abbildung des konkret existierenden Schlosses Chillon (ein Unikat). Das Bild links ist eine Idealzeichnung einer mittelalterlichen Burg (ein Typ). Beide Bilder stammen aus demselben Lexikon.
|
||
Zweites Beispiel für ›Homonymie‹
Bei den Bildern auf der Hand von Girolamo Marafioti (tätig zwischen 1595 und 1627) handelt es sich um Gedächtnishilfen, um sich eine Rede einzuprägen. (Vgl. hierzu generell: Jörg Jochen Berns / Wolfgang Neuber u.a., Ars memorativa. Zur kulturgeschichtlichen Bedeutung der Gedächtniskunst 1400–1700, (Frühe Neuzeit 15), Tübingen: Niemeyer 1993.) Bei den Bildern auf der Hand im Brockhaus-Lexikon handelt es sich um das Bild einer mit astrologischen Zeichen bezeichneten Hand. Aus dem Text des Artikels: Die Hand wurde zu dem Ende [zum Zweck der Vorhersage des Zukünftigen] in die Handwurzel, Handfläche und die Finger geschieden, deren 12 Gelenke der gelehrte Chiromant mit den 12 Himmelszeichen, die sieben Hauptlinien der Hand mit den Planten in Beziehung zu bringen wußte, welche diese Theile gleichsam beherrschen sollten. Weiterführende Links: |
||
Drittes Beispiel für ›Homonymie‹Wenn auf einem Bild, das den heiligen Hieronymus zeigt, ein Löwe abgebildet ist, so ist dieser als das Tier Löwe zu deuten, zurückgehend auf die Legende, wonach Hieronymus einem Löwen einen Dorn aus der Tatze zog und die Wunde pflegte, worauf der geheilte Löwe als Haustier bei ihm blieb. Vgl. den Text in der »Legenda Aurea« (13. Jh.) > https://www.heiligenlexikon.de/Legenda_Aurea/Hieronymus.htm
Wenn auf einem Bild, das den Evangelisten Markus zeigt, ein Löwe abgebildet ist, so handelt es sich nicht um ein echtes Tier, sondern um das (echt wirkend wiedergegebene) ›Logo‹ dieses Mannes, das zurückgeht auf die Zuordnung der vier Tier-Gesichter in der Vision des Ezechiel (Tetramorph Ez 1,10) zu den vier Evangelisten. (vgl. > Tetramorph)
|
||
Viertes Beispiel für ›Homonymie‹Wir kennen das Schema: Von den Einzelteilen eines visualisierten Objekts führen Linien oder Pfeile zu Zahlen oder Buchstaben oder direkt zu kleinen Legenden, die sagen, was man dort abgebildet sieht. (Vgl. das Kapitel zur Bild-Text-Verknüpfung.) Hier zunächst ein Beispiel aus einem Bildwörterbuch, wo die Semantik verdeutlicht wird:
Bei dem sehr ähnlich aussehenden Aderlassmann hier verweisen die Buchstaben indessen auf den Ort, wo der Bader oder Arzt das Messer ansetzen soll:
Äusserlich ähnlich sieht ebenfalls das Bild bei Geoffroy Tory (1480–1533) aus; es meint aber etwas ganz anderes: Es zeigt Korrespondenzen zwischen den Gliedern des Leibs und geistigen Größen. Abgebildet ist l’homme parfaict. Die 23 Buchstaben verweisen nicht auf anatomische Begriffe, sondern auf die 9 Musen, die 7 Artes Liberales, die 4 Kardinaltugenden und die 3 Grazien. – Bild plus Verweisbuchstaben plus Legende ist also eine dreispaltige Parallel-Tabelle, in der die Körperteile den 23 Buchstaben und von hier aus Personifikationen zugeordnet werden. Beispiele aus dem Text:
|
||
Beispiele für ›Synonymie‹Insofern als Synonymie weniger zu Missverständnissen beim Bildverstehen führt, können wir uns mit einem Beispiel begnügen. ••• Erstes Beispiel: Menschengruppen Ein Lexikon für Jugendliche aus dem Jahr 1952 bringt einen Artikel über die verschiedenen Menschengruppen auf der Erde. (Über Rassentheorien in Lexika unterhalten wir uns hier nicht; es geht einzig um die Visualisierung von Daten.) Präsentation 1. Der Text nennt die mengenmäßige Verteilung in Zahlen; das ist das zu visualisierende Objekt:
Präsentation 2. Mit Excel aufgrund dieser [korrigierten] Daten hergestellte Balkengraphik (PM Juli 2016) Präsentation 3. Mit Excel aufgrund dieser Daten hergestellte Kuchengraphik (PM Juli 2016; leider sind die Farben im Programm nicht wählbar…) Präsentation 4. Im Stil von Otto Neurath 1952 gezeichnete Graphik aus dem genannten Lexikon:
Alle diese Darstellungen leisten inhaltlich dasselbe, sie unterscheiden sich aber hinsichtlich der Präsentationsform. Die Kuchengraphik zeigt (bzw. insinuiert), dass damit die ganze Weltbevölkerung erfasst ist. Die anthropomorphe Graphik hat einen mnemotechnischen Vorteil. Mehr zum Thema der tabellarischen Visualisierungen hier.
••• Zweites Beispiel: Zugehörigkeit von Staaten zu Institutionen Präsentation 1:
Präsentation 2:
|
||
Fallstudie zu einem ähnlich aussehenden Bildmotiv in verschiedenen Kontexten — und dementsprechend mit verschiedenen Bedeutungen••• Viele Autoren haben die Tiere, die sie in einer Gegend kennengelernt haben, – ohne Rücksicht auf deren Biotope – zu Kompilationsbildern zusammengestellt (vgl. das Kapitel zur Bildvielheit) In Bernhard von Breidenbachs Pilgerbericht (zuerst 1486 gedruckt) steht ein Holzschnitt, auf dem die Tiere zusammengestellt sind, die er gesehen haben will: Hec animalia sunt veraciter depicta sicut vidimus in terra sancta – in der deutschen Fassung (Speier: Drach 1490): Dise thier synt warlich abkunterfeyt als wir sie haben gesehen yn dem heiligen land.
Ein weiteres Beispiel aus einem der von den Brüdern de Bry illustrierten Reiseberichte: Tafel XIII: Abbildung allerley wilden Thierer so in Guinea gefunden werden.
In den nächsten beiden Beispielen handelt es sich nicht um ein Kompilationsbild, weil hier die Meinung ist, dass die verschiedenen Tiere wirklich so an einem Ort sich zusammenfanden: ••• Bei der Schöpfung der Tiere durch Gott:
••• Die Tiere zusammen mit Adam und Eva im Paradies, x mal dargestellt; hier:
••• Die Prophetie des Tierfriedens in Jesaia 11,6ff.: Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Hierzu dieses Bild:
••• Das Titelkupfer zu einem der Bände von Barthold Hinrich Brockes (1680–1747) zeigt eine ähnliche Ansammlung von Tieren; gemeint ist hier aber die Aufforderung, man möge in der ganzen Schöpfung den allmächtigen, weisen, gütigen Schöpfer erkennen (Physikotheologie):
••• Um die Fruchtbarkeit des alten Teütschen erdtrichs bildlich umzusetzen, verwendet ein solches Bild der Drucker Sebastian Henricpetri in seiner Ausgabe von Sebastian Münsters »Cosmographie« 1567 (man beachte nebst den einheimischen Tieren wie Gemse und Bär das Einhorn, den Elefanten und das Nashorn unter Palmen! Münster wehrt sich gegen die antiken Schriftsteller, namentlich Tacitus, der Germanien als öde darstellt):
••• In diesem Sinne realistisch ist auch das Bild mit Orpheus und den verschiedenen Tieren zu verstehen, das seit der römischen Antike überliefert ist. Bei Ovid, Metamorphosen X,143 steht: ... vates ... in ferarum concilio, medius turba volucrumque sedebat (der Sänger saß von Tieren der Wildnis umringt und von Scharen von Vögeln.) Nachdem Orpheus’ Vortrag beendet ist, heißt es, dass er mit solcherlei Liedern die wilden Tiere herbeigelockt habe (XI, 1 und 20ff.).
• Diese Vorstellung wird dann in der Emblematik allegorisch gedeutet. So wie Orpheus mit seinem Wohlklang die wilden Tiere zähmt, so soll der Herrscher sein Amt sanft ausüben.
• Der Verleger Sigmund Feyerabend übernimmt die Orpheus-Ikonographie für die Titelvignette seiner Pliniusausgabe. (Er ist auch sonst nicht zimperlich, Bilder aus anderen Kontexten dorthin zu verpflanzen; vgl. dazu das Kapitel zu den wandernden Bildern.)
• Was Orpheus und die Tiere auf dem Titel eines Buch zur Jagd zu tun haben?
••• Wiederum anders zu verstehen ist dieses Kompilationsbild: Es handelt sich um ein Titelkupfer, das mittels Verweis-Bildern ankündigt, welche Wesen im Buch behandelt werden (allerlei Vögel, Walfisch, Hornvieh, Affe, Nixe, Faun, doppelköpfiges Schwein, Feuersalamander u.a.m.), diese aber abbildet, als wären sie in einer mimetischen Landschaft dargestellt. Das Bild erinnert an Darstellungen des 6.Schöpfungstages (das erste Menschenpaar unter allen Geschöpfen im Paradies), und so mag es die Idee evozieren wollen: diese Wesen leben alle in Gottes wundersamer Welt.
••• Genau gleich geht der Gestalter des Titelbilds zu Aesop-Fabeln vor, nur dass es sich hier im Gegensatz zu denjenigen bei Caspar Schott um fiktionale Tiere handelt. (Aesop wird übrigens immer als verwachsener Mann dargestellt).
••• Eine andere Aussage macht das Bild mit der Vielzahl von Tieren im »Sachsenspiegel« des Eike von Repgow (zwischen 1209 und 1233 urkundlich erwähnt). Der (nach unserer Logik etwas seltsame) Gedankengang läuft so: Gott hat den Menschen bei der Schöpfung über alle Tiere Macht gegeben; daraus ist aber nur zu folgern, dass niemand sein Leben an diesen verwirken kann, indessen nicht das allgemeine Recht auf Jagdfreiheit. Im Land Sachsen gibt es drei Gebiete (sog. Bannforste), an denen für alle Tiere außer Bären und Wölfe (in anderen Hss. auch Füchse und Wildschweine) ›Frieden gilt‹. Das meint: Wer hier wilde Tiere fängt (außer die genannten) muss eine Geldstrafe bezahlen (Landrecht, II.Buch, § 61).
Das obere Bild entstammt der herkömmlichen Ikonographie der Schöpfung der Tiere und des Menschen. – Im unteren Bild sitzt der König an Gottes Stelle und waltet mit Befehlsgestus über sein Regal, wonach Hase, Hirsch und Reh (außer vom adligen Inhaber des Jagdregals) nicht gejagt werden dürfen. (Wohl damit die Parallele zu Gott stimmt, sind im Bild von der Schöpfung dieselben Säugetiere gezeichnet.) Vgl. Brigitte Janz, Rechtssprichwörter im Sachsenspiegel. Eine Untersuchung zur Text-Bild-Relation in den Codices picturati, Frankfurt am Main: Lang 1989 (Germanistische Arbeiten zu Sprache und Kulturgeschichte Band 13), S. 481ff. ••• Wiederum völlig anders ist das Bild mit den Tieren zu verstehen auf Dürers Bildnis von Kaiser Maximilian (Holzschnitt in der »Ehrenpforte«, zuoberst vor der Kuppel, ca. 1515) Die Tiere, die den Kaiser umgeben, sind Hieroglyphen nach damaligem Verständnis (Horapollo): Der Hund mit der Stola steht für den besten Fürsten, weil er in den Tempel eintreten kann; der Basilisk auf der Krone steht für unsterblichen Ruhm; der Stier für Mäßigung; der Kranich mit dem Stein in der Kralle für Wachsamkeit usw. (Zur komplizierten Druckgeschichte der Legende vgl. Ludwig Volkmann, Bilderschriften der Renaissance. Hieroglyphik und Emblematik in ihren Beziehungen und Fortwirkungen, Leipzig: Hiersemann 1923, S.87ff. Die Tituli der Ehrenpforte Maximilians I. stammen von Johannes Stabius; die lat. Übersetzung ist von Benedictus Chelidonius). |
||
Online seit Juli 2016 (P.M.); Ergänzungen Nov.23. |
||