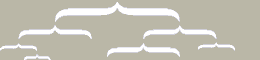
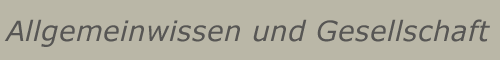
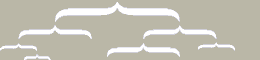 |
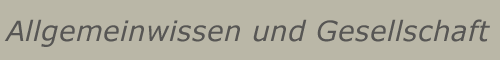 |
|
Von Buch zu Buch wandernde BilderVom Ende des 15. Jahrhunderts an kamen viele bebilderte Bücher auf den Markt. Nur sehr renommierte Verleger schafften es, sie einheitlich und in hoher künstlerischer Qualität auszustatten. Die Nachfrage an Bildmaterial überstieg das Angebot offensichtlich bald. Die Verleger mussten gelegentlich auf Bilder zurückgreifen, die aus einem bereits bestehenden Werk stammten. Manchmal gelang dies unanstößig, wenn das Bild eine so allgemeine Aussage machte, dass es auch in einem anderen Kontext verwendet werden konnte. Oft aber gingen sie (nach unserem Empfinden) recht unzimperlich vor und montierten Bilder in Kontexte, wo sie keine rechte Aussage mehr leisteten, sondern nur noch eye catcher waren. (Wir kennen den Trick aus unserer Tagespresse.) Anmerkung: Aby Warburg hat den Begriff »Bilderwanderung« geprägt. Auf dieser Webseite hier geht es nicht um die Übernahme mentaler Konzepte wie in dessen »Mnemosyne«-Atlas (wie die »Erbmasse phobischer Engramme einzuverseelen« ist), auch nicht um ikonographische Traditionen, sondern vor allem um Kopien und sogar materielle Übernahmen von Buch zu Buch. A.Warburg und den Folgen ist dieses Projekt gewidmet: https://iconology.hypotheses.org/uber Ältere Einschätzung der Originalität: Abgesehen von merkantilen Überlegungen der Buchdrucker: Einen Stoff von innen her aus der künstlersichen Subjektivität heraus gestalten (Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik (1835/38 > https://textlog.de/5730.html) ist ein neuzeitliches Programm. In der vor-neuzeitlichen Kunst gelten Anschauungen wie diese:
Die literarische Intertextualitätsforschung hat hier Differenzierungen vorgenommen;
Hinsichtlich der Präzision der Übernahme lässt sich eine Skala ansetzen: • Übernahme des Druckstocks bzw. der Kupferplatte • Übernahme des Bilds, allenfalls mit stilistischer Adaptation • Ausgeklammert wird hier die Tradition eines ikonographischen Typs (z.Bsp. die Darstellung der Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies oder das Pferd vor Troja u.ä.) Einige Typen von Übernahmen: • Mehrfache Verwendung eines stilisierten (und so auf vieles passenden) Bildes innerhalb desselben Buchs ⬇ • Bild-Teile in verschiedenen Kombinationen ⬇ • Ein Bild-Fundus speist mehrere ähnliche Bücher ⬇ • Stilistische Änderung bei der Übernahme ⬇ • Schlechte Kopie ⬇ • Missverständnis (Bsp.: Ausgabe des Narrenschiffs 1574) ⬇ • Inhaltliche Verbesserung in einer Neuauflage ⬇ • Augmentation in einer Neuauflage ⬇ • Bild in ein inhaltlich anderes Buch übernommen, wo es hinsichtlich der Aussage einigermaßen hinpasst ⬇ • Bild verpflanzt in ein inhaltlich anderes Buch, wo es nicht in den Kontext passt ⬇ • Übernahme in einen neuen Kontext, wo das Bild sogar eher besser passt ⬇ • Speziell zur Ausgabe des Polydor Virgilius 1537 ⬇ • Vom Flugblatt ins naturwissenschaftliche Werk ⬇ • Von der Mythologie / Bibel ins naturwissenschaftliche Werk ⬇ • Zitat ⬇ (vgl. C. Gessner, J.J.Scheuchzer⬇, Grandville ⬇ , allenfalls Sebastian Brant ⬇) • Bild-Übernahmen in Kinder-Enzyklopädien ⬇ • Bild-im-Bild ⬇ • Vom unsorgfältigen Umgang mit den Druckstöcken ⬇ • Reprint – – – Raubdruck ⬇ • Exkurs: Kunst-Kopie ⬇ Es gäbe noch weitere Typen (die hier weitgehend ausgeklammert werden), z.B. Parodie, Karikatur usw.
Hinweise auf Forschungsliteratur hier unten |
||
Vorgehensweise von Verlegern im 16. Jahrhundert••• Heinrich Steiner (auch Steyner, Stainer, Stayner; gest. 1548) verlegte 82 bebilderte Drucke, bis er 1547 bankrott ging. Zielpublikum war offensichtlich die humanistisch angehauchte Oberschicht von Bürgern, die auf Übersetzungen angewiesen war und dem gediegenen Buchschmuck zugeneigt. Irgendwann übernahm er die Drucktypen und Druckstöcke aus der Konkursmasse der Druckerei Grimm und Wirsung, die 1527 konkurs ging, und damit die seit 1521 bereitliegenden, aber nie gedruckten Holzschnitte eines (bis heute unbekannten) Meisters, die für die Übersetzungen von Ciceros »de officiis« (1531 erschienen) und von Petrarcas Trostbuch (1532 erschienen) bestimmt waren. Diese Bilder hat Steiner dann für weitere Bücher wiederverwendet. Ausserdem hat er Druckstöcke weiterer Bücher benutzt. ⬇ Nach seinem Konkurs erwarb der Frankfurter Drucker Christian Egenolff (1502–1555) das Material und verwendete es weiter. Literaturhinweise: Georg Wilhelm Zapf, Augsburgs Buchdruckergeschichte nebst den Jahrbüchern derselben; Erster Theil (Vom Jahre 1468 bis auf das Jahr 1500), Augsburg: Bürglen, 1786 – Zweyter Theil (Vom Jahre 1501 bis auf das Jahr 1530), Augsburg: Stage 1791. Hans-Jörg Künast, ›Getruckt zu Augspurg‹. Buchdruck und Buchhandel in Augsburg zwischen 1468 und 1555, Tübingen: Niemeyer 1997. Helmut Gier / Johannes Janota (Hgg.) Augsburger Buchdruck und Verlagswesen von den Anfängen bis zur Gegenwart, Wiesbaden: Harrassowitz 1997. ••• Der Frankfurter Verleger Sigmund Feyerabend (1528–1590), ein ausgebildeter Formschneider, war ein Ikonomane. Er konnte wohl auf einen Fundus von Druckstöcken zurückgreifen, die er aus in Konkurs gegangenen Druckereien erworben hatte, und illustrierte damit ziemlich wahllos seine Erzeugnisse. > https://de.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Feyerabend (enthält eine Liste von Drucken aus seinem Verlag 1556 bis 1577); Portrait von Feyerabend (digitaler Portraitindex). ⬇ ••• Zu nennen wäre auch die Basler Verleger- / Drucker-Dynastie Petri ⬇ (vgl. http://www.altbasel.ch/dossier/henric_petri.html): Praxis von naturwiss. Forschern im 16. / 17. / frühen 18. Jahrhundert• Conrad Gessner (1516–1565) hat für seine zoologischen und (infolge seines frühen Todes nicht erschienenen) botanischen Werke viele Zeichnungen selbst angefertigt; das haben die Funde und Forschungen von Florike Egmond und Sachiko Kusukawa neuerdings bestätigt. Dennoch musste er – obwohl er das bestimmt nicht mochte – viele Bilder aus fremden Quellen beiziehen. Walfische entnimmt er Olaus Magnus; das Nashorn stammt von Dürer; der Octopus kommt aus G.Rondelets Fischbuch. ⬇ und ⬇ • Die 750 je aus verschiedenen Motiven zusammengesetzten Bilder seiner Enzyklopädie »Physica Sacra« konnte Johann Jacob Scheuchzer (1672–1733) unmöglich alle aus eigener Anschauung beibringen; er zitiert laufend Bilder aus einem riesigen Fundus von Quellen. ⬇ Buntschriftstellerei im 17. Jahrhundert• Eberhard Werner Happel (1647–1690) beschloss 1680, sich als hauptberuflicher Literat durchzubringen – etwas für die damalige Zeit völlig Ungewöhnliches. Er ist mithin einer der frühesten Journalisten. Unter anderem gibt er die »Grösten Denckwürdigkeiten der Welt (Relationes Curiosae)« heraus, das ist ein der Unterhaltung dienendes buntes Wochenblatt, das er seit 1683 in dem dafür spezialisierten Verlag Wiering publiziert. Darin rezykliert er Reiseberichte, wissenschaftliche Werke, historische Quellen usw., die er in der ›Gemeinen Bibliothek‹ in Hamburg zusammentrug. Stark vereinfachtes Wissen second hand. ⬇ |
||
Bemerkungen zum TechnischenIm selben Buch mehrfach verwendete Holzschnitte Man muss sich vergegenwärtigen, wie Drucker in der Frühzeit vorgegangen sind: Man konnte nicht ein z.Bsp. hundertseitiges Buch auf éin Mal setzen und dann ausdrucken. Dazu reichte der Typenvorrat nicht. (Das Metall war mitunter das Wertvollste in einer Offizin.) Vgl. den Artikel > https://de.wikipedia.org/wiki/Bleisatz Man setzt beispielsweise einen Bogen (je nach Format z.Bsp. 16 Seiten), zieht dann einen Probedruck (›Bürstenabzug‹) davon ab, dann wird Korrektur gelesen und korrigiert (mit der Pinzette falsche Typen, z.Bsp. ein ›Fliegenkopf‹ oder ›Zwiebelfisch‹ ausgetauscht), sodann wird der ganze Bogen in der verlangten Auflagenhöhe ausgedruckt. — Dann wird der Satz aufgelöst und die Typen werden wieder in den Setzkasten abgelegt. Jetzt kann der nächste Bogen gesetzt werden. So werden auch die Druckstöcke jedes Mal wieder frei für eine Weiterverwendung.
Hier ein typisches Beispiel für die Wiederholung einer Schlachtendarstellung in verschiedenen Kontexten:
Technisches zur Wiederverwendung von Holzschnitten Hölzerne Druckstöcke sind sehr auflagenbeständig; man kennt Fälle, wo über tausend Abzüge vom gleichen Druckstock schadenfrei abgezogen wurden. Mitunter kommt es freilich vor, dass freistehende Randkanten abbrechen. Die Schrifthöhe der Metall-Lettern stimmt mit der Höhe der Druckstöcke überein, so dass der gesetzte Text mit dem Bild in einem einzigen Durchgang gedruckt werden kann – anders als im Kupfertiefdruck. In der frühen Neuzeit war die Höhe weitgehend standardisiert (‹Frankfurter Höhe› = 68 Punkt ≈ 25,5 mm), und so konnten die Bilder von verschiedenen Druckern mit den eigenen Typen verwendet werden. Christoph Reske, Der Holzstock bzw. Holzschnitt am Ende des 15. Jahrhunderts. Aspekte der Arbeitsteilung, Kosten und Auflagenhöhe, in: Gutenberg-Jahrbuch 84 (2009), 71–78. Zur Technik des ›Abkupferns‹ Der Kopist legte das originale Bild auf die entsprechend präparierte Kupferplatte und rieb die Vorlage strichweise durch (frz. [dé-]calquer). So entstand auf der Kupferplatte eine Reproduktion, die man dann weiterverarbeitete, d.h. ätzte und stach. Der Abdruck davon auf Papier ergab dann natürlich ein seitenverkehrtes Bild des Originals. Das stört nicht zwingend. Freilich kann es vorkommen, dass dann ein Held oder eine Heldin das Schwert mit der linken Hand führt oder hier die beiden befreundeten Männer einander die linke Hand geben: Das Emblem von Otto van Veen (1556–1629) beruht auf einem Text von Horaz (Satire I, 3, Vers 68ff.): Alle Menschen haben Vorzüge und Fehler; die Freundschaft besteht darin, dass der Tugendhaftere dem Schwächeren hilft und die ungleich-gewichtige Waage ausgleicht. (Was genau in den beiden Waagschalen liegt, ist nicht klar.) Hier das Original:
Hier die Kopie:
›Bestandserhaltung‹ Gelegentlich sind die Verleger auch sehr ruppig mit den Bildern umgegangen. Ein Beispiel unten ⬇ |
||
Mehrfache Verwendung eines Bildes innerhalb desselben BuchsErstes Beispiel: Für unser modernes Empfinden ist es seltsam, dass auch ›Portraits‹ von verschiedenen Persönlichkeiten mit denselben Bildern visualisiert werden. Es geht wohl um etwas anderes als die Wiedergabe des Bilds einer individuellen Person. Verschiedene Kaiser in der Schedelschen Weltchronik 1493 (am bequemsten digital erreichbar hier > https://de.wikisource.org/wiki/Schedel'sche_Weltchronik). Die 596 Bildnisse der Schedelschen Weltchronik sind von nur 72 Druckstöcken gedruckt. Justinian — Karl der Große — Lothar II. — Heinrich VI. — Karl IV.
Die Individualität einer Person ist offensichtlich nicht gebunden an ihre bildliche Repräsentation – wie auch damals? Das Bild steht als Chiffre für ›Kaiser‹. Wenn Individuelles visualisiert werden soll, dann zeigt man das Monogramm des Regenten. Noch in Sebastian Münsters »Cosmographey« Basel 1588 (Seite ccccxiiij) wird Karl der Große mit seiner ›Unterschrift‹ charakterisiert: Zweites Beispiel: Komplizierte Holzschnitte von Schlachten mit ineinander verkeilten Lanzen werden innerhalb desselben Buches rezykliert (Beispiel Stumpf-Chronik Zürich 1547). Hier geht es einfach darum, zu zeigen: Damals fand eine Schlacht statt. Vgl. hierzu besonders den Aufsatz von Matthias Oberli, Schlachtenbilder und Bilderschlachten. Kriegsillustrationen in den ersten gedruckten Chroniken der Schweiz, in: Anfänge der Buchillustration = Kunst + Architektur in der Schweiz […], Jahrgang 57 (2006), 45–53. Der Illustrator der ersten deutschen Livius-Übersetzung (1505) kennt immerhin ein Mittel, verschiedene Schlachten zu unterscheiden: Er hat im Druckstock die Fahnen so ausgeschnitten, dass er verschiedene vexillologische Motive einfügen konnte. Man beachte die Fahne in der oberen linken Ecke.
Drittes Beispiel: Es stört anscheinend nicht, wenn in einem aufgeschlagenen Buch auf der linken und auf der rechten Seite dasselbe Bild steht, das zwei unterschiedliche Ereignisse (links Hannibals Belagerung der Stadt Casilinum / rechts die Belagerung von Syracus) darstellt:
Viertes Beispiel: Derselbe Holzschnitt dient als Illustration des Erdbebens von Basel anno 1356 — des antiken Philadelphia in Kleinasien — desjenigen von Syracus anno 1070. Es handelt sich offensichtlich nicht um eine mimetische Abbildung dieser Städte, sondern um eine Art Pictogramm für ›Erdbeben‹:
Conrad Lycosthenes muss in seinem Buch (1557) immer wieder über Erdbeben als Vorzeichen oder Strafe berichten. Dazu hat er ein Set von Holzschnitten bereit. Einige sind aus anderen Büchern übernommen, u.a. aus der Cosmographia, die ja im gleichen Verlag erschienen war.
|
||
Bild-Teile in verschiedenen KombinationenDiese Technik hat ein lange Tradition, von der Inkunabelzeit bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts. Literturhinweis: Gero Seelig, Inkunabelillustration mit beweglichen Bildteilen, in: Gutenberg-Jahrbuch, 70. Jahrgang (1995), Wiesbaden: Harrassowitz, S. 102–134. Erstes Beispiel: A Die Ausgabe der Komödien des Terenz von Johann Grüninger in Straßburg (1496) enthält 162 Holzschnittillustrationen. Um den Arbeitsaufwand für die Herstellung der Druckstöcke zu reduzieren, schuf man ein Set kombinierbarer Holzschnitte mit den wiederkehrenden Personen und Kulissen. So reduzierte sich die Anzahl der zu schneidenden Druckstöcke auf 88. (nach https://www.ub.uni-heidelberg.de/ausstellungen/buchkunst2014/sektion2/II_04.html)
B Ebenfalls bei Grüniger erscheint 1498 eine Horaz-Ausgabe, die bei der Bebilderung ebenfalls Teile kombinierend vorgeht. Dazu wurden Holzschnitte aus der Terenz-Ausabe rezykliert; zwecks Unkenntlichmachung der Figur wurden einfach einzelne Buchstaben aus dem Titulus herausgeschnitten:
Zweites Beispiel: Die mit dem Szepter in der Hand/Pfote regierenden Löwen wurden in der Ausgabe Das buch der weißhait oder der alten weisen, Ulm: Lienhart Holl 1484 ( > http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00029362/image_1) jeweils neu geschnitten: Der Verleger Lienhart Holl machte 1484 Konkurs. — Grüninger dagegen hat éin solches Löwenbild, das er je neu kombiniert; hier einige Beispiele:
Dieselbe Technik findet sich auch in Grüningers Druck des Hug Schapler:
Drittes Beispiel: Das Buch von Boethius (* um 480/485; † zwischen 524 und 526) ist konzipiert als Dialog zwischen dem Autor und der personifizierten Philosophie, die ihn tröstet und belehrt. Die beiden Gestalten werden in verschiedenen Holzschnitten repräsentiert, die ein unbekannt gebliebener Straßburger Meister schuf. Einige davon kommen in der illustrierten Ausgabe 1501 immer wieder in verschiedenen Kontexten vor.
Um dort, wo der Kommentar den Raum nicht einnimmt, die Bildfläche in den Satzspiegel (bzw. das Raster von Primärtext und Kommentarspalten) einzubinden, fügte der Layouter auf derselben Höhe kleinere Bilder hinzu, damit kein Weißraum entsteht. Dabei verwendet er dieselben Druckstöcke wiederholt. Vom Bild von Boethius und Philosophia gibt es mehrere Varianten. Es werden aber auch einige Holzschnitte mit diesen beiden Figuren wiederholt. Zum Beispiel: Fol. Xr – Fol. XXVIIr – XLr – LVr – LVIIr – LXIIIv – LXXXIIv – CVIIr.
Der Text dazu (Liber I, metrum 4) lautet:
Das zum Text passende Hauptbild (links der Mitte) zeigt das tobende Meer und den Flammen speienden Vulkan. Rechts daneben Boethius und die Philosophie, die diese Naturerscheinungen betrachten; die Schraffierung des landschaftlichen Hintergrunds ist so geschnitten, dass der Übergang zwischen den Bildern einigermaßen stimmt. Dasselbe Verfahren verwendet Schöffer für seine Livius-Ausgabe 1505 – und nach ihm findet es Verwendung in den Ausgaben von Grüninger 1507 und Schöffer 1533; mehr dazu >>> hier.
Ein im Text oft wiederkehrendes Motiv ist die Gerichts- / Verhandlungs- / Beratungsszene. Erzählmuster: Jemand begeht eine Übeltat – er wird vor einem Gremium verhört – dann ins Gefängnis geführt oder hingerichtet, oder auch freigesprochen. Für diese Szene verwendet der Drucker Bilder, die er mit den anderen Szenen kombiniert. Die Holzschnitte sind so eingerichtet, dass an der Seite, wo die beiden kombiniert werden, sich eine Säule befindet. Auf diese Weise wird der Trick kaschiert. (Für die Verhandlungs-Szene gibt es verschiedene Bilder; wir konzentrieren uns auf eines.) Wir zeigen hier drei Fälle mit derselben Verhandlungs-Szene. Dieser Druckstock wird elfmal verwendet und mit verschiedenen (z.T. auch denselben) Szenen kombiniert: Fol. VIII verso – XXII recto – XLIII v – XXXVII v – XLV v – LXXI r – LXXVI r – CLX Ir – CLIX r – CCLVII r – CCCLXVI r.
Fünftes Beispiel: Ebenso arbeitet diese Übersetzung des Eusebius [Caesariensis] durch Johannes Hartlieb mit zusammengesetzten Bildteilen:
Sechstes Beispiel:
Siebtes Beispiel: Auch die Stumpf-Chronik (EA 1547) macht von diesem Mittel Gebrauch und kombiniert Schlachtendarstellungs-Teilbilder:
Literaturhinweis: Paul Leemann-Van Elck, Der Buchschmuck der Stumpfschen Chronik, Bern: Haupt 1935 (Bibliothek des Schweizer Bibliophilen. Serie 2; Heft 5) – Der Verfasser zählt 440 Kriegsszenen. Achtes Beispiel: Ausgaben mit der deutschen Übersetzung von Boccaccios Decamerone gehen seit Grüninger 1509 [noch nicht überprüft] so vor. Hier aus einer späteren Ausgabe:
Neuntes Beispiel: In der in Mainz bei Ivo Schöffers Erben 1551 und 1557 erschienenen Livius-Ausgabe wird von dem Kombinations-Verfahren ausgiebig Gebrauch gemacht. Man fragt sich, woher diese zugesägten Bildteile stammen. Es geht offensichtlich darum, ein Bild räumlich zu situieren (der Kriegselefant Fol. xcij recto tritt gegen ein Heer an und dies unter dem meteorologischen Himmel); gelegentlich artet diese Technik aber auch in Pfusch aus, weil die Bildstöcke nicht zusammenpassen (Fol. xlviii recto):
|
||
Ein ständig ergänzter Bild-Fundus speist mehrere ähnliche BücherChristoph Weigel d.Ä. (1654–1725) publiziert 1698 eine (hierarchisch) geordnete Darstellung der Ämter, Künste und Handwerke, in der die Texte von Bildern begleitet sind. Die Kupfertafeln enthalten – ähnlich wie Embleme – einen Titel und ein Motto; unter dem Bild sechs ins Allegorische changierende Verse. Weigel steht in einer Tradition:
••• Christoph Weigel lässt sehr exakte Kopien anfertigen. Georg Christoph Eimmart d.J. (1638–1705) trägt weitere bei, mit präzisen Darstellungen der Werkzeuge; die Vorzeichnungen sind erhalten. Mehrere Kupfer stammen wiederum von C. Luyken (S. 72 ist signiert: Casper Luyken invent et f ; ebenso S. 178: C.L.). Weitere Stiche hat Weigel selbst verfertigt (auf der Kiste mit CW signiert S. 172). Die Bilder unterscheiden sich denn auch stilistisch, vgl. im Detail die hervorragende Arbeit von Bauer 1982.
••• Kurz nach dem Druck von Weigels Ständebuch, 1699, erscheint der erste – von Abraham a Santa Clara (1644–1709) verfasste – Band von »Etwas für alle« im Verlag Christoph Weigel in Würzburg:
Der Text von Pater Abraham geht jeweils aus von den Berufen, kippt dann aber regelmäßig ins Erbauliche, wenn sich eine mehr oder weniger passende Gelegenheit ergibt. »Etwas für alle« enthält Kupferstiche (inklusive den in die Platte gestochenen Text) aus dem eben erschienenen Ständebuch von Weigel. Es scheint, dass die Bilder von Anfang an für das Ständebuch und dasjenige von Abraham a.S.C. geplant waren, denn es existieren 74 Kupfer, die nicht in das Ständebuch aufgenommen wurden, dann aber in »Etwas für Alle« (I bis III) eingegangen sind. (Abbildungen im Anhang der Faksimile-Ausgabe, hg. Michael Bauer, Nördlingen: A.Uhl 1987; vgl. dort auch S.15ff.) ••• Nach dem Hinschied von Abraham a Santa Clara wurde »Etwas für alle« von einem (recht stümperhaften; vgl. Horber 1929) Autor in zwei Bänden – ebenfalls mit Bildern, die bei Weigel offenbar bereit lagen – weitergeführt. Es sind darunter mehrere, die nicht Berufe im engeren Sinne darstellen (z.Bsp. Das Coffee-Haus, Der Beutelschneider, Der Comœdiant) und deshalb in Weigels Ständebuch nicht verwendet wurden. Hier ein Bild aus dem 2.Band (S.135ff.) , das auch im Ständebuch (S. 113ff.) vorkommt (Bildgröße 8 x 9 cm):
Ein zweites Beispiel desselben Verlegers ••• Um die Jahrhundertwende erscheint bei Weigel die »Ethica Naturalis«: 100 Stiche von Jan und Caspar Luyken; dazu pro Bild auf einer Seite lateinische Verse von (rekonstruiert bei Bauer) Paul Hansiz S.J. (1645–1721). Das Buch gehört in die Tradition der Emblematik: Lemma — Pictura — Epigramm mit Moralisation. Es ist enzyklopädisch angelegt, reicht von den Gestirnen über meteorologische Erscheinungen, Landschaften, Pflanzen,Tageszeiten, Jahreszeiten, Tiere, Menschenleben bis zu Katastrophen (Krieg, Pest, Erdeben).
••• Weigel verwendete die vorhandenen Kupferplatten und die (typographisch gesetzten) lat. Texte, um 1707 (2. Auflage 1710) mit den deutschen Übersetzungen und (mehrseitigen) Prosa-Texten von Abraham a Sancta Clara ein weiteres Werk herauszugeben:
••• Georg Andreas Will (1727–1798, vgl. in der ADB) wird ein deutsche Fassung zugeschrieben, die erschien, als Weigels Enkel Johann David Tyroff dem Verlag vorstand. Die Verse und die predigthaften Erweiterungen von Pater Abraham sind hier weggelassen; der Text ist vereinfacht und modernisiert; es passen Bild und Text je auf eine Doppelseite (r/v). Gemäß Vorwort hat das Buch auch eine physikotheologische Absicht: Man soll aus diesen Blättern, die nichts anderes, als physisch-moralische Schilderungen sind, die Grösse und Mannichfaltigkeit in den Reichen der Natur und Sitten, die nach Absicht des Schöpfers von je her verbunden sind, erkennen.
••• Das Buch ist mit diesen Kupfern auch in Russland erschienen:
Literaturhinweise: Ambros Horber, Echtheitsfragen bei Abraham a Sancta Clara, Weimar: Duncker, 1929 (Forschungen zur neueren Literaturgeschichte 60); hier bes. S. 35–41 zur Kompilation des Kapitels E.f.A. II Der Cantor. Franz M. Eybl, Abraham a Sancta Clara. Vom Prediger zum Schriftsteller, Tübingen: Niemeyer 1992 (Frühe Neuzeit 6), S. 360ff. zu Weigel. Michael Bauer, Christoph Weigel (1654–1725), Kupferstecher und Kunsthändler in Augsburg und Nürnberg, in: Archiv für Geschichte des Buchwesens, Band 23 (1982), Sp. 693–1186.
|
||
Inhaltliche Veränderung bei der ÜbernahmeFür Veränderungen in Neuauflagen gibt es den trivialen Grund, dass der Druckstock / die Kupferplatte nicht mehr erreichbar war. Unterschiede in der graphischen Neufassung können verschiedene Gründe haben: mangelndes Können – Korrektur – Missverständnis – modischer Einfluss – … Erstes Beispiel: In der offensichtlich vom Petrarcameister illustrierten Plautus-Ausgabe von 1518 gibt es ein Bild einer Tischgesellschaft:
Eine frühe Schrift von Sebastian Franck (1499–1542) trägt den Titel
Schrifttype und Aufmachung mit dem Titelbild verweisen deutlich auf einen Druck von Heinrich Steiner in Augsburg. Die Widmung an Wolff von Heßberg ist datiert auf 1528. — Der Titel-Holzschnitt der Tafelgesellschaft und des sich Erbrechenden ist aus zwei Teilen zusammengesetzt, wie das damals oft gemacht wurde (siehe oben). Der Stil ist eindeutig derjenige des Petrarcameisters.
Das zentrale Bild auf dem Titel von S.Franck zeigt an sich eine fröhlichen Tischgesellschaft. Vielleicht ist der sich Erbrechende auf dem ergänzenden Druckstock eine Zugabe, womit das ›Laster der Trunkenheit‹ inszeniert wird. (Aber wofür hätte der Meister das zentrale Bild allein verwenden sollen?) In Von der Artzney bayder Glück, Augspurg: H. Steyner 1532 (1. Buch, Kapitel xix; Fol. XXIr) sagt die Freude Ich frewe mich inn Wirtschafften. Petrarca lässt die Vernunft die prunkvollen Einladungen kritisieren, bei denen es nur darum gehe, sich der vornehmen, reichen Gäste zu rühmen, dabei handle es sich bei diesen doch nur um Hofierer, Schwelger und Schmarotzer, die sich vollfressen wollen. Es fallen die Worte trunckenheit und frässerey. Die Kombination von fröhlicher Tischgesellschaft und dem sich Erbrechendem passt gut zum Dialog zwischen Freude und Vernunft. Hier ist das Bild (interessanterweise seitenverkehrt) anders gestaltet: Holzschnitt in éinem Stück und mit dem herausgerückten Motiv der Speisen hereintragenden Frau breiter (15,5cm). Der Meister fertigte für das Glücksbuch in aller Regel Holzschnitte an, die in den Satzspiegel passten. So übernommen wird das Bild dann – passend zum Thema Von grossen essern – in: Johannes Pauli, Schimpff und Ernst, Augspurg: Heynrich Steiner 1534. Digitalisat > http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00084286/image_94
Anhang 1: Der Petrarcameister könnte sich für den zweiteiligen Bildaufbau inspiriert haben an der Darstellung im Buch von Johann Geiler von Kayserberg (1445–1510), das das Vberflüssiglich oder zeuil essen illustriert:
Anhang 2: Äußerst seltsam mutet die Übernahme des Bilds im Kochbuch von Marx Rumpolt an, dem Mundkoch des Mainzer Kurfürsten. Die sich erbrechende Figur fügt sich nicht chic zu den Rezepten für das Bancket der Bürger/ darinn vermeldet/ was für Speiß vnd Trachten/ nicht allein auff die Fleisch-/ sondern auch auff die Fasttage zuzurichten seyen. — Aber der Verleger Feyerabendt bedient sich auch sonst recht unverschämt der Druckstöcke in seinem Vorratslager.
Zweites Beispiel: In Ciceros »De officiis« II, 88–90 geht es um ein Abwägen zwischen äußeren Gütern (z.B. Reichtum) und inneren (z.B. Gesundheit). Der Übersetzer Johannes von Schwarzenberg formuliert in der Randglosse: Wie zwischen zwaien nutzen dingenn das nützer zuo erwölen. Der Illustrator visualisiert das als eine Frau, die eine Balkenwaage hält, auf deren Waagschalen die Güter liegen. Diese sind angeschrieben mit Innerliche güeter / Eüsserliche güeter (als in Lücken des Druckstocks eingefügte Typen.)
Der Verleger Heinrich Steiner verwendet den Holzschnitt 1537 wieder, wo der Autor Polydorus Vergilius darüber spricht, Wer erstlichen die Gewichten/ die Gemäß/ vnd Zal erdacht hab (1. Teil, Kapitel 19). Eine Waage als Bild kann er gut gebrauchen; die in diesem Kontext störenden Texte werden einfach weggelassen.
|
||
Stilistische Änderungen bei der ÜbernahmeErstes Beispiel: Conrad Gessner (1516–1565) zitiert als Gewährsmann gelegentlich Olaus Magnus (1490–1557), »Historia de gentibus septentrionalibus« (1555). Von den übernommenen Bildern lässt er neue Holzschnitte anfertigen.
Zweites Beispiel: Die »Vier Bücher vom Wahren Christentumb« von Johann Arndt (1605/09, 1612 zu 6 Büchern erweitert; die Embleme zuerst in der Ausgabe Riga 1678/79) haben viele Neuauflagen erfahren. Vgl. hierzu: Dietmar Peil, Zur Illustrationsgeschichte von Johann Arndts ›Vom wahren Christentum‹. Mit einer Bibliographie. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens, Vol. 18 (1977), S. 963–1066. •••Hier ein Bild in der älterem Tradition.
In einem Druck des 19.Jhs. sind die emblematisch gedeuteten Gegenstände, die in den älteren Auflagen graphisch freigestellt waren, naturalistisch kontextualisiert, was der damaligen Mode entsprach: Das Fernrohr wird mit einem durch es schauenden Betrachter abgebildet; das Sieb mit einem Korn siebenden Bauern usw. Das Kornfeld ist hier in eine Genre-Szene eingebettet: eine Bauernfamilie bei der Ernte. — Dadurch ist die ursprünglich intendierte Aussage verwischt: Der Blick wird abgelenkt von den vollen bzw. leeren aufrecht stehenden Ähren.
••• Die Einbettung in einen Lebenskontext kann umgekehrt auch eine Verständnishilfe sein. Beispiel: Zwiebeln schneidet man
Zuerst nochmals Bild und Text aus der Ausgabe Zürich 1746. Die (eine Zwiebel ergreifende) Hand kommt – wie in der Emblematik häufig – aus Wolken. Aber wo sind die Tränen? In einer Ausgabe aus dem 19.Jahrhundert ist die Zwiebelschälerin bei der Arbeit samt Tränen ersichtlich:
Drittes Beispiel: Conrad Lycosthenes (1518–1561) berichtet zum Jahr 823, dass der verruchte polnische König Popielus dann und wann – auch wenn er im Unrecht war – schwor, wenn es nicht wahr sei, so sollten ihn die Mäuse fressen. Das geschieht dann einmal tatsächlich. (Warum das in einem Boot geschieht, geht aus dem Text nicht hervor. Quelle wird eine Geschichte Polens sein, wonach Popielus versuchte, die Mäuse so abzuwehren. Das Bild fehlt in der deutschen Übersetzung.)
Das Magasin Pittoresque, das viele Ereignisse der Kulturgeschichte der Vergangenheit populärwissenschaftlich aufarbeitet, bringt das Bild in einer stilistisch modernisierten Version. (Auch der erklärende Text ist modernisiert, worauf hier nicht eingegangen wird.)
Viertes Beispiel: Der Zorn als Narrheit wird (von wem? Chr. Weigel? Jan Luyken?) so imaginiert:
Dasselbe Kupfer erscheint dann auch in dem (Abraham a Sancta Clara fälschlich zugeschriebenen) Buch Centi-Folium stultorum in Quarto. Oder Hundert Ausbündige Narren in Folio, neu aufgewärmet und in einer Alapatrit-Pasteten zum Schau-Essen, mit hundert schönen Kupffer-Stichen, zur ehrlichen Ergötzung, und nutzlichen Zeit-Vertreibung, sowohl frölich- als melancholischen Gemüthern aufgesezt/ auch mit einer delicaten Brühe vieler artigen Historien, lustiger Fablen, kurtzweiliger Discursen, und erbaulicher Sitten-Lehren angerichtet, Nürnberg: Weigel / Wienn: Megerle 1709; Nr. 97
In Amsterdam erscheint sodann ein thematisch sehr ähnliches Buch, für das aber neue Kupfer angefertigt wurden.
Fünftes Beispiel: Circe verzaubert die Gefährten von Odysseus in Schweine (Ovid, Metamorphosen XIV, 278ff.). Während die Radierung von Antonio Tempesta (*ca. 1555 – 1630) eine Frische, Dynamik der Linienführung zeigt,
ist die Nachahmung (vgl. unten bei Raubdruck) feiner ausgeführt (malerisch – homogen), aber damit auch fade:
Sechstes Beispiel: Der Nürnberger Graphiker und Formschneider Virgil Solis (Nürnberg, 1514–1562) hat immer wieder profitiert von den Holzschnitten des Bernard Salomon (Lyon, ca. 1506–1561). Ein Vergleich anhand einer Ovid-Illustration (Szene mit Erichthonius, Met. II, 552ff.) zeigt, dass er die Vorlagen verfeinerte und stilistisch verbesserte:
Mythologisch-ikonographischer Exkurs zu Erichthonius
Siebentes Beispiel: Postum erschienen die Bilder von Christoph Murer (1558 –1614) als Emblembuch, darin die Nummer XIX:
Der mit Murer verschwägerte Zürcher Conrad Meyer (1618–1689) hat dies abgezeichnet. Dass das Bild im Vergleich zur Radierung (1622) horizontal gespiegelt erscheint, lässt vermuten, dass Meyer die Vorzeichnung von Murer vorgelegen hat. (Das leider verunstaltete Manuskript ist erhalten in der Zentralbibliothek Zürich, Ms Z VI 439) Interessant sind die stilistischen Veränderungen: Achtes Beispiel: <A> Holzschnitt > Kupferstich (bzw. Radierung) und <B> Kupferstich > Holzschnitt <A> Kandaules, König von Lydien, ließ seinen Leibwächter Gyges die Reize seiner Gemahlin im Schlafgemach bewundern. Erzürnt über solche Schmach, ließ die Frau Gyges zu sich kommen und stellte ihm die Wahl, entweder den König zu morden, oder augenblicklich erdrosselt zu werden. Gyges tötete darauf den Kandaules. Antike Quellen: Herodot, Historien I, 8–13 — Justinus, Epitoma Historiarum Philippicarum, I, vii. (nudam sodali suo Gygi ostendit) > lat. Text Sebastian Brant, Das Narren schyff (1494), Kapitel 33: Von eebruch. Vers 71f.: Sebastian Brant hat höchstwahrscheinlich den Petrarcameister für die Illustrationen von Petrarcas Glücksbuch (1532) inspiriert, wo sich im 1. Buch, Kapitel lxvi (Von einem hüpschen Weyb) ein Holzschnitt mit der Voyeur-Szene findet – der Text Petrarcas erwähnt die Candaules-Episode nicht.
Derselbe Holzschnitt erscheint dann in der bei Steiner erschienenen Übersetzung von Boccaccios »De casibus virorum illustrium« (auch hier kein Texthinweis auf Candaules; obwohl das Bild zum Kapitel Wider die eusserlich hübsche/ vnnd schendtliche lieb gut passt):
Während der Petrarcameister im Hintergrund die Szene darstellen lässt, wo eine Frau vor ihrem Fenster Radau machende Leute mit dem Nachttopf begießt (vgl. Narrenschiff Kap. 62), zeigen andere Illustratoren die Folgen der kompromittierenden Aktion: die Tötung des Kandaules; dieselben Personen erscheinen nochmals. Jacob Cats (1577–1660) kennt diese Szene ebenfalls:
Auf dem Bild von Matthäus Merian d.Ä. im Geschichtsbuch von Johann Ludwig Gottfried wird bei der Voyeur-Szene die Gattin von einer Kerze beschienen – bei der Tötung hält sie eine Kerze!
Die Kopie hier ist gröber gearbeitet:
Exkurs: Johann Fischart ließ die Szene für sein »Ehzuchtbüchlein« von Tobias Stimmer (1539–1584) zeichnen. Der Holzschnitt mit den Maßen 4,6 x 6 cm wirkt wie eine Abbreviatur:
Nachtrag zum literarischen Stoff: Die Anekdote wird später öfters erzählt, z.B. bei [m Nachfolger von] Peter Lauremberg, Neue und vermehrte ACERRA PHILOLOGICA, Das siebende Hundert nützlicher und denckwürdiger Historien, Nr.70: Närrische Liebe Candaulis <B> Die kleinen Bilder von François Chauveau, Le Brun u.a. in Metamorphoses d'Ovide en rondeaux, imprimez et enrichis de figures, Paris: Imprimerie royale 1676 (Digitalisat) wurden mehrmals kopiert (Plagiate). Hier als Beispiel die Gefangennahme der ehebrecherischen Paars Venus und Mars durch das Netz des Vulcan (Ovid, Metamorphosen IV, 171–189): Tiefdruck in Tiefdruck (Kupfer)
Tiefdruck in Hochdruck (Holzschnitt) umgeformt:
Neuntes Beispiel Der vielseitige Graphiker Hans Witzig (1889–1973) illustrierte in Holzschnitttechnik ein Lesebuch für Primarschüler. Dabei griff er immer wieder auf Bilder zurück.
H. Witzig hat das Motiv auch verwendet in seinem Jugend-Roman »Fortunatus«. Bei diesem Holzstich muss man schon von einer künstlerischen Adaptation reden:
Literaturhinweis: Anna Lehninger: Punkt, Punkt, Komma, Strich. Hans Witzig als Autor, Illustrator und Zeichner, in: LIBRARIVM, 2018/II, S.104–117. Zehntes Beispiel: Die Bilder zur Geschichte des Kampfs von Atilius Regulus mit dem Drachen in ›Livius‹-Drucken von 1505 bis 1637 > hier Elftes Beispiel: Hier handelt es sich weniger um eine stilistische Adaptation, eher um eine inhaltliche: Matthäus Merian (geb. 1593 in Basel) bildet unter dem Emblem zum Thema
Johann/Hans J. Sulzer (Winterthur, 1631–1665) und Heinrich Werdmüller (1630–1678) signieren gelegentlich Radierungen in einer Serie von Kopien dieses Emblembuchs. Hier ist die Stadtvedute durch die von Zürich ersetzt. Blick von Süden über dem See, von links nach rechts: Fraumünster mit den zwei romanischen Türmen – St. Peter (mit hohem Turm) – Limmat, hier zuvorderst der Grendel mit dem Wellenberg-Turm – rechts Großmünster:
Anmerkung: Merian bringt in Nr. 28 (Jam proximus ardet) ebenfalls eine Ansicht von Zürich, hier von Norden limmataufwärts gesehen; dies ist in der Kopie so übernommen. Weitere Beispiele Sebastian Brant-Nachdrucke auf dieser Seite hier |
||
Graphisch schlechte KopieEin aus vielen verschiedenen Holzschnitten zusammengestoppeltes Werk ist »Das Büchle Memorial« des Johann von Schwarzenberg (1463–1528). Das Buch verdiente eine genauere Untersuchung. Nur ein Beispiel: Auch hier verwendet Steiner Bilder des Petrarcameisters. Und wo sie nicht genau passen, werden sie (schlecht) neu gefasst.
Das Bild stammt aus Petrarcha, Von der Artzney bayder Glück (1532), Erstes Buch, Kap. 76 Fol. XCIII verso, wo es um die Wiederverheiratung eines Witwers geht. (Dass die beiden Szenen simultan dargestellt sind, meint nicht satirisch: der Mann verheiratet sich sofort wieder, noch während seine erste Frau beerdigt wird; Simultandarstellungen von zeitlich auseinanderliegenden Handlungen sind in Bildern häufig.) Die Szene rechts, wo die erste Frau zu Grabe getragen wird, passte nicht zum Thema im »Memorial«, wo es um das Lob des ehelichen Stands geht. Ob Steiner den Druckstock nicht gerade bei der Hand hatte oder das Original des Petrarcameisters nicht zersägen und für eine spätere Verwendung schonen wollte? Tatsächlich bleibt der originale Druckstock erhalten und wird später wieder verwendet. Juan Luis Vives (1492–1540), »De institutione feminae christianae« (lat. Erstausgabe Oxford 1523), eine Erziehungslehre für Mädchen und Frauen, wurde ins Deutsche übersetzt und 1544 von Heinrich Steiner mit Bildern des Petrarcameisters herausgegeben. Hier passt das Bild inhaltlich perfekt, denn das Thema (2.Buch, Kapitel 11) ist: Von denen die zum andern mal vermähelt/ vnd Stieffmüter seind.
|
||
Inhaltlicher FehlerDas »Narrenschiff« von Sebastian Brant (Erstausgabe Basel: Bergmann von Olpe 1494) erfuhr bald Neuausgaben und Raubdrucke, vgl. hier unten. Interessant ist die revidierte Neuausgabe Basel 1574. Die Holzschnitte in kleinerem Format stammen von Tobias Stimmer (1539–1584), der Text wurde sprachlich dem neuen Stand angepasst und jedem Kapitel wurden aus Geiler von Kaysersberg übernommene moralische Ausführungen angehängt. Herausgegriffen sei das Kapitel »Nit volgen gutem ratt.« / »Der VIII Narr.« Das Bild basiert auf den Versen:
Das Wort pfluog ist doppeldeutig: (a) das Ackerwerkzeug; (b) ›Lebensweise‹ (etymologisch zu pflegen = etwas besorgen, umgehen mit; vgl. den Kommentar von Zarncke zur Stelle). Bildlich kann natürlich nur (a) realisiert werden. In der ursprünglichen Ausgabe (Basel 1494) sowie in beiden Nachschnitten 1497 wendet sich der den Pflug ziehende Narr nach hinten um. Hier schwingt die Stelle aus dem Lukas-Evangelium 9,61f. mit. — Diese Stelle wird im Kap. 82 (mit demselben Bild) explizit erwähnt:
Der Holzschnitt von Tobias Stimmer 1574 zeigt diese Gebärde nicht: Der Narr zieht den Pflug vorwärts blickend. S.Brant (1457–1521) stand damals nicht mehr mit einem Ratschlag neben dem Zeichner.
Exkurs: Georgette de Montenay (1540–1581) hat das Gleichnis bildlich richtig umgesetzt. Die Doppelung von ziehendem Pflüger und Pflugknecht (mit dem gouch = Kuckuck auf der Hand) bei Brant ist verwirrend. Hier ist nur éin (zurück blickender) Mann im Bild, und der Pflug wird von Pferden gezogen (wobei das eine den Kopf ebenfalls nach hinten wendet!):
|
||
Inhaltliche Verbesserung in NeuauflageErstes Beispiel: Narrenkappe In seinem Buch »De remediis utriusque Fortunae« (Von den Heilmitteln der beiden Arten von Glück) lässt Petrarca (1304–1374) im ersten Teil die Personifikationen Fortuna, Gaudium und Spes auftreten, die allerlei Arten des Glücks preisen, wonach Ratio jeweils mahnt, diese Glücksgüter seien letzten Endes eitel; im zweiten Teil grämen sich Dolor und Metus über allerhand Arten von Drangsalen und werden von Ratio getröstet. Was den Menschen erfreut, erweist sich als nichtig, und wovor er sich fürchtet, erweist sich bei genauerem Zusehen als Segnung. – Zur Organisation des Buchs vgl. hier den Artikel von R.Stutz. Nach langen Vorarbeiten und Verzögerungen wird 1532 die deutsche Übersetzung gedruckt: Franciscus Petrarcha, Von der Artzney bayder Glück / des guten vnd widerwertigen […]. Augspurg: H. Steyner MDXXXII. [Faksimile, hg. und kommentiert von Manfred Lemmer, Leipzig 1984] Im ersten Teil, Kapitel 100 jubelt die Freude: Jch hab einen schatz gesamlet zum kriegen. Dagegen wendet die Vernunft ein: Ein böses ding zuo noch bösserm gepraucht/ wye vil besser were es/ dir vnd andern nutzlicher/ denselben zuo geprauch deyner freünd vnd vatterland gesammelt haben/ vnd am maisten der notturftigen/ das were als dann ein warer schatz/ vnd ein belonung hymlischen schatzs/ yetzt ist es ein lon der helle. Aber die Freude bleibt unbelehrbar. (Übersetzung der Ausgabe 1532) Das Bild der Erstausgabe (1532) zeigt einen Mann, mit einer Narrenkappe, der an einem Tisch vor einem Haufen Geld sitzt und mit der rechten Hand in einem Sack voll Münzen wühlt; neben ihm stehend ein Mann mit einer Schreibfeder und ein weiterer mit einer Liste; vor dem Tisch stehen zahlreiche Landsknechte, die von dem Reichen ausbezahlt werden. Das Bild ist wohl inspiriert von Sebastian Brant, »Narrenschiff« (1494), Kapitel 3 Von gytikeit [Habsucht] Der ist eyn narr der samlet guot und Kapitel 83: von verachtung armut Gelt narren sint ouch über al In beiden Kapiteln dasselbe Bild:
Ein Narr mit der typischen Kappe sitzt an einem mit Geld und Wertgegenständen bedeckten Tisch, zwei Männer treten in den Raum, der eine lüpft den Hut und sagt (Schriftzug über der Figur wie später in den Sprechblasen): gnad her (›Mit Verlaub, Herr!‹; gemeint ist eine Bitte um Unterstützung). – Habsucht und Verachtung der Armut werden als Narrheit beurteilt. Narrheit ist indessen bei Brant keineswegs ein harmloser Defekt, sondern eine Ausprägung von Gottlosigkeit; vgl. Barbara Könneker (1966). Bereits 1533 verwendet der Verleger Steiner den Holzschnitt zur Illustration der deutschen Übersetzung des Buchs von Marinus Barletius über die Taten von Georg Kastriota genannt Skanderbeg (1405–1468): Des allerstreytparsten vnd theüresten Fürsten vnd Herrn Georgen Castrioten/ genannt Scanderbeg/ Hertzogen zu Epiro vnd Albanien etc. Ritterliche thaten/ so er zu erhalten seiner Erbland/ mit den Türckischen Kaysern in seinem leben/ glücklich begangen / Jn Latein beschriben/ Vnd yetz durch Joannem Pinicianum Newlich verteütscht, Augspurg: Steiner 1533. Zum Kapitel Wie sich Scanderbeg rüstet/ wyder belgrad zuo ziehen/ vnd schickt zum Künig Alphonso vnb hilff, in dem erzählt wird, wie er Kriegsvolk mustert (Fol. CXLVII verso) passt die Szene mit der Anheuerung von Landsknechten, die Narrenkappe indessen nicht; sie wird entfernt. Das ist technisch sehr geschickt ausgeführt; es ist nicht erkennbar, dass der Mann einmal eine Narrenkappe trug. (Bloß die Schelle auf der rechten Schulter ist stehengeblieben.) In der Neu-Ausgabe des Glücksbuchs Augsburg: Heynrich Steyner 1539 fehlt dann natürlich die Narrenkappe auch. Das ist gar nicht so übel, denn Petrarca sagt nicht, Reichtümer anzuhäufen und damit Kriege zu finanzieren, sei bloß närrisch. Sondern es werden harte Ausdrücke verwendet: Rem malam in usus pessimos! – pretium est inferni – pestiferum (Petrarca im Original) Ein böses ding – ist böß (Übersetzung 1532) zu bösem brauch – Gelt gibt zum bösen vrsach vil – so ists böse (Übersetzung 1539). Zweites Beispiel: Die Sphinx 1579 erscheint die erste Auflage von Laurentius van Goidtsenhoven (Laurentius Haechtanus, 1527–1603), »Mikrokosmos. Parvus Mundus« mit Kupferstichen von Gerard de Jode (1509–1591) in seinem Verlag in Antwerpen. Das Buch wurde mehrmals neu aufgelegt; für die Ausgaben 1618 und später wurden die Kupfer von Jacob de Zetter (wie üblich seitenverkehrt) nachgestochen. Diese sind etwas gröber herausgekommen, was hier nicht interessiert. Betrachten wir Nr. 41: Sphinx. Die Sphinx gibt den Thebanern bekanntlich folgendes Rätsel auf: »Welches Wesen, das eine einzige Stimme hat, geht morgens auf vier Füßen, mittags auf zweien und abends auf dreien?« Oedipus vermag es zu lösen: Es ist der Mensch, der als Kleinkind auf allen Vieren krabbelt, als Mann zweibeinig marschiert und als Greis am Stock geht. Die antiken Quellen zu Sphinx sind hier zusammengestellt: https://www.theoi.com/Ther/Sphinx.html Die hinsichtlich Aussehen genaueste antike Quelle der Geschichte ist APOLLODOR, »Bibliothek«, III,v,8. Er beschreibt die Sphinx so: Sie hatte das Gesicht einer Frau, die Brust, die Füße und den Schwanz eines Löwen und die Flügel eines Vogels, … 1579
1618
Vgl. die deutsche Fassung: Jacob Zetter, Speculum virtutum & vitiorum. Darinnen nicht allein Tugend und Erbarkeit/ Zucht und gute Sitten/ Wie auch Laster/ und Untugend/ sondern auch der Welt mores, artig und anmühtig/ Beydes durch Kunstreiche Kupffer/ als auch artige Teutsche Historische und Moralische Reimen werden abgemahlet und fürgebildet. Francofurti: Zetter 1644 > http://diglib.hab.de/drucke/lo-8314/start.htm?image=00094
Bei Heliodor, Historien II,175 ist Sphinx auch maskulin, er meint aber die ägyptische Skulptur der Sphinx. In der mittelalterlichen Ikonographie gibt es durchaus auch männliche Sphingen. Spätestens ab der Auflage von 1608 war Sfinge Thebana superata da Edipo bei Vincenzo Cartari, Le imagini dei degli antichi (p. 274) als weibliches Wesen abgebildet:
Drittes Beispiel: Von ›West-Indien‹ nach Japan Theodor de Bry (1528–1598) und sein Sohn Johann Theodor de Bry (1561–1623) edierten bedeutende Reiseberichtsammlungen: die West-Indischen Reisen und die Ost–Indischen Reisen. Hier interessiert die deutsche Fassung der americanischen Historien von Johann Ludwig Gottfried (1584–1633). Johann Ludwig Gottfriedt, Newe Welt vnd Americanische Historien. Inhaltend warhafftige und vollkommene Beschreibungen aller West-Indianischen Landschafften, Insulen, Königreichen und Provintzien, Seecusten, fliessenden und stehenden Wassern, Port und Anländungen, Gebürgen, Thälern, Städt, Flecken Wohnplatzen, zusampt der Natur und Eygenschafft dess Erderichs, […] Item, historische und aussführliche Relation 38. Fürnembster Schiffarten underschiedlicher Völcker in West-Indien, von der ersten Entdeckung durch Christophorum Columbum, in 150. Jahren, vollbracht. Franckfort: Bey denen Merianschen Erben 1631. Seite 41 ist die Rede von Beichtpraktiken der Americaner. Und da holt J. L. Gottfried aus zu einem Exkurs:
Der Vielschreiber (Buntschriftsteller) Erasmus Francisci (1627–1694) hat 1668 eine umfangreiche Enzyklopädie exotischer Erdteile kompiliert. Sein Werk umfasst aber mehr als nur ›Westindien‹, sondern auch ›Ostindien‹, d.h. China und Japan: Erasmi Francisci Ost- und West-Indischer, wie auch Sinesischer Lust- und Stats-Garten: […] In Drey Haupt-Theile unterschieden. Der Erste Theil Begreifft in sich die edelsten Blumen/ Kräuter/ Bäume/ Heel- Wasser- Wein- Artzney- und Gifft-gebende Wurtzeln/ Früchte/ Gewürtze/ und Specereyen/ in Ost-Indien/ Sina und America: Der Ander Theil Das Temperament der Lufft und Landschafften daselbst; die Beschaffenheit der Felder/ Wälder/ Wüsteneyen; die berühmten natür- und künstliche Berge/ Thäler/ Hölen; imgleichen die innerlichen Schätze der Erden und Gewässer ... folgends unterschiedliche wundersame Brunnen/ Flüsse/ Bäche/ ... abentheurliche Meer-Wunder; Lust- Spatzier- Zier- Kauff- und Kriegs-Schiffe: Der Dritte Theil Das Stats-Wesen/ Policey-Ordnungen/ Hofstäte/ Paläste/ denckwürdige Kriege/ Belägerungen/ Feldschlachten/ fröliche und klägliche Fälle/ Geist- und Weltliche Ceremonien/ merckwürdige Thaten und Reden der Könige und Republicken daselbst. Wobey auch sonst viel leswürdige Geschichte/ sinnreiche Erfindungen/ verwunderliche Thiere/ Vögel und Fische/ hin und wieder mit eingeführet werden ..., Nürnberg/ In Verlegung Johann Andreæ Endters / und Wolfgang deß Jüngeren Sel. Erben. Anno M.DC.LXVIII. Er ›zitiert‹, was ihm unterkommt, und er bedient sich auch des Kupfers aus de Bry / Gottfriedt (wie üblich: seitenverkehrt). Dabei besinnt er sich, dass der Text ja von einem Brauch in Japan handelt. Und so legt er seinem Graphiker nahe, die Handelnden nicht mit indianischem Kopfschmuck, sondern mit einem japanischen Chignon auszustatten, vgl. dazu wikipedia.org/wiki/Chonmage (S. 1042, Ausschnitt):
Literaturhinweise: Viertes Beispiel: Cesare Ripa (* um 1555 bis 1622) ärgerte sich nach dem Erscheinen der ersten bebilderten Ausgabe (1603) seiner »Iconologia« über Fehler, welche die Illustratoren gemacht hatten. Ein Beispiel: Der Graphiker hatte nicht beachtet, dass der Text zur Personifikation der SAPIENZA sagt: Giovane in vna notte oscura …
In der Ausgabe 1618 wurde das berichtigt. Das Licht der Sapienza erhellt jetzt einen dunkeln Raum:
Literaturhinweise zu Cesare Ripa: Alice Thaler, Die Signatur der Iconologia des Cesare Ripa: Fragmentierung, Sampling und Ambivalenz. Eine hermeneutische Studie, Basel: Schwabe-Verlag 2018.
Fünftes Beispiel: ›Verbesserung‹ infolge Zensur 1522 erscheint die deutsche Übersetzung des neuen Testaments von Martin Luther (das sog. ›Septembertestament‹). Während die Evangelien und die bedeutenden Paulusbriefe mit Kommentaren am Rand versehen sind, enthält die Apokalypse keine Kommentare. Luther zweifelte nach der Begegnung mit den religiösen Schwärmern (den sog. ›Zwickauer Propheten‹) am Wert dieses biblischen Buches, das ihm zu visionär war und die evangelische Botschaft zu wenig klar ausdrückte. In der Vorrede zur »Offinbarung« formulierte er dieses Misstrauen deutlich, und der Text ist 1522 wohl deshalb nicht paginiert. Ganz im Gegensatz dazu steht, dass die Apokalypse und einzig sie bebildert ist. Die 21 ganzseitigen Bilder (im Kleinfolio-Format) stammen teils von Lukas Cranach d.Ä. (1472–1553), teils aus seiner Werkstatt. Luther mögen verschiedene Gründe bewogen haben, hier Bilder zuzulassen; es mag sein, dass ihm die polemischen Spitzen gegen das Papsttum zupass kamen, die man so nicht expressis verbis zu formulieren brauchte. Das Tier aus dem Abgrund (Apk 11,7), der Drache (Apk 16,7) und die Babylonische Hure (Apk 17,1) tragen die an den drei Reifen erkennbare päpstliche Krone, die Tiara. Apokalypse 17,1ff in Luthers Übersetzung 1522:
Am 7. November 1522 erließ Herzog Georg von Sachsen (›der Bärtige‹), ein vehementer Luther-Gegner, ein Verbotsmandat gegen das Septembertestament, das mit etlichen schmehlichen figuren bebstlicher heiligkeit zu schmehen versehen sei. — Kurfürst Friedrich der Weise, um gute Beziehungen zu Rom und den Kaiser bemüht, erwirkte eine Abmilderung: In der im Dezember 1522 erscheinenden Neuauflage wurden die drei Holzstöcke mit den Bildern des Tiara tragenden Monsters bearbeitet; die oberen beiden Kronringe der Tiara wurden weggeschnitten, so dass sie wie eine weltliche Krone aussieht. Das sieht dann so aus: Literaturhinweise: Peter Martin: Martin Luther und die Bilder zur Apokalypse. Eine Untersuchung zur Ikonographie der Illustrationen zur Offenbarung des Johannes in der Lutherbibel 1522 bis 1546. Hamburg: 1983 (Vestigia Bibliae Band 5). Vgl. Heimo Reinitzer, Biblia deutsch. Luthers Bibelübersetzung und ihre Tradition (Ausstellungskatalog der Herzog August Bibliothek 40), Wolfenbüttel: HAB 1983; Nr. 109 und Abb. 115 und Nr. 100, Abb. 103a: Eine (katholische) polnische Bibel 1561; der Künstler übernimmt Cranachs Bild und lässt die oberen beiden Kronreifen weg. Sechstes Beispiel: In Petrarcas Buch von zweierlei Glück handelt Buch II, Kapitel 92 Von dem sterben oder pestilentz die seer weit tobt vnd weret. Beim Bild des Petrarcameisters ist bereits in der Erstausgabe 1532 links oben etwas weggeschnitten:
Der Verleger Steiner hat vorher das Buch von Luis Lobera de Avila, Vanquete de nobles Cavalleros, Augsburg: Heinrich Steiner [ohne Datum] – auf Spanisch! herausgegeben. Das v.a. die gesunde Ernährung thematisierende Buch erschien bei Heinrich Steiner 1531 auch deutsch unter dem Titel Ein nutzlich Regiment der gesundtheyt/ Genant das Vanquete/ oder Gastmal der Edlen diener von der Complexion/ Eigenschafft/ Schad/ vnd nutz allerley Speyß/ Trancks/ vnd von allem/ darmit sich der mensch in gesundtheyt enthelt/ (Das LIII Capitel Von einem kurtzen vnd fast nutzlichen Regiment/ zu enthalten/ preseruieren/ vnd zu heylen eine yetlichen menschen in pestilentzischer zeyt enthält aber das hier interessierende Bild nicht. > https://dibiki.ub.uni-kiel.de/viewer/image/PPN641539479/3/LOG_0002/) Die Druckstöcke für das Petrarca-Buch waren bereits verfügbar, nachdem der ursprünglich vorgesehene Verleger Grimm in Augsburg 1527 Konkurs gegangen war und Steiner die Materialien übernommen hatte. In dem Buch Vanquete de nobles Cavalleros ist der Holzschnitt noch intakt:
Warum wurden die Pestheiligen Rochus und Sebastian für den Druck 1532 weggeschnitten? Vermutlich weil die Augsburger Konfession (1530) in Artikel 21 das Anrufen von Heiligen um Hilfe verbot.
|
||
AugmentationUnter den Vergil zugeschriebene Texten (›Appendix Vergiliana‹) befindet sich der Text »Culex« (Die Mücke). Man hat diesen Text auch schon für einen echten, von Vergil stammenden aufgefasst und gedeutet als eine launische, ins Allegorische umgesetzte Selbstbiographie. Text:
Sebastian Brant verwendet 1501 Kurzversionen in seinem bebilderten und mit Moralisationen versehenen Buch:
Ein Jahr später, 1502, druckt Brant den ganzen Text in seiner bebilderten Ausgabe der Werke Vergils im Appendix ab:
Abgesehen von der stilistischen Änderung: Die Gestalten in der Unterwelt sind dazugekommen; ebenso das Grab. |
||
Verschiebung in eine Publikation, wo das Bild passtErstes Beispiel In der Chronik von P. Etterlin (1507) werden dieselben Schlachtenbilder ebenfalls mehrfach verwendet. Beispiel: Fol. XCI verso, CVII verso und CIX verso.
Der Verleger Heinrich Petri ist offenbar an diesen Holzschnitt seines Basler Kollegen Michael Furter († 1517) gelangt und hat ihn wieder-verwendet für diese Schlacht:
Auch in der Ausgabe von Sebastian Münsters Cosmographie verwendet H.Petri diese Schlachtbilder aus der Etterlin-Chronik mehrmals:
Zweites Beispiel In zweiten Teil von Petrarcas »Von der Artzney bayder Glück« (Erstauflage 1532) beklagt sich die Personifikation des Schmerzes, dass sie unrechtmäßig gepeinigt werde. Der Meister zeichnet zwei Szenen: auf der einen Seite Torturen, wie sie in den Halsgerichtsordnungen beschrieben werden; auf der anderen Seite die Szene mit der Geschichte des Perillus, die der Text im ersten Buch, Kap.95 behandelt und der Meister dort illustriert. Perillus (Πέριλλος), ein Künstler in Metallarbeit in Athen, der für den Tyrannen Phalaris in Agrigent einen ehernen Stier mit hohlem Leibe verfertigte, in den Verbrecher gesteckt und durch untergelegtes Feuer gebraten werden sollten. Der Künstler wurde vom Tyrannen genötigt, zur Probe selbst in den Stier zu kriechen, und kam so ums Leben. (Plinius, nat. hist. XXXIV, xix, 89 und andere Autoren)
Das Bild wurde kopiert (so erklärt sich, dass es seitenverkehrt ist) für die Exempelsammlung von Andreas Hondorff (ca. 1530–1572), das »Promptuarium Exemplorum« (1.Ausgabe Leipzig 1568; weitere Drucke 1570 bis 1598 fast jährlich; zuletzt 1687). Hier ist das Thema das Leiden der frühchristlichen Märtyrer.
1585 erschien von Tommaso Garzoni (1549 – 1589) »La piazza vniversale di tvtte le professioni del mondo«. Es handelt um eine Zusammenstellung von Regenten und Tyrannen, Schulmeistern und Schulfüchsen, von Alchimisten, Metzgern und Fleischhauern, Wahrsagern, Hexenmeistern, Hofleuten, Bettlern, Huren, Gerbern, Scharfrichtern, Buchdruckern usw. in kunterbunter Reihe. Das Werk ist nicht einfach eine Präsentation von Faktenwissen, sondern spielt mit der enzyklopädischen Tradition. Das Werk wurde 1619 genial ins Deutsche übersetzt; dieser Text wurde noch drei Mal neu aufgelegt. In der Ausgabe 1641 (in Quart; zweispaltig) sind Holzschnitte (6 x 8 cm) eingefügt, die Jost Amman (1539–1591) für das »Ständebuch« geschaffen hatte.
Herkunft:
Das Bild des ›Intellektuellen‹ mit melancholischer Gebärde hat der Verleger der griechisch/lateinischen Fassung des Ständebuchs (ebenfalls 1568 erschienen) entnommen, in der deutschen Fassung kommt es nicht vor. In Garzonis »Schauplatz« erscheint es vier Mal: 14.Discurs. Von den Academicis, oder Schul-Lehrern — 26.Discurs: Von Philosophis ins gemein/ und hernach von […] — 27.Discurs: Von den Oratoribus oder Rednern — 38.Discurs: Von den Historicis oder Geschichtschreibern.
Viertes Beispiel: 1580 erscheinen die Siben Bücher Von dem Feldbau/ vnd vollkommener bestellung eynes ordenlichen Mayerhofs oder Landguts. Etwann von Carolo Stephano und Johanne Liebhalto/ der Artzeney Doctorn/ Frantzösisch beschrieben. Nun aber seines hohen nutzes halben, gemeynem Vatterland zulieb/ von dem Hochgelehrten Herren Melchiore Sebizio Silesio, der Artznei Doctore, inn Teutsch gebracht. […]. Getruckt zu Straßburg/ bei Bernhard Jobin 1580. Darin stehen jeweils zu Beginn der ersten sechs Bücher Holzschnitte wie dieser: (Bildgröße 11,8 x 15 cm) Das Monogramm MF mit dem daneben liegenden Messer in der Ecke links unten ist dasjenige eines unbekannten Formschneiders, der für Virgil Solis und Tobias Stimmer gearbeitet hat (Nagler Monogrammisten IV, #1197, #1775, #1777). — Die Frau bringt Apoll (Lyra und Pfeile als Attribut) ein Opfer dar – ob er auch für den Gartenbau zuständig ist? Die Bilder erscheinen 1605 wieder in Künstliche Wolgerissene Figuren und Abbildungen Etlicher Jagdbahren Thieren/ vnd andern zu Lustigem Weydwerck gehörenden Stücken. Weiland von den beyden Berühmten vnd Fürnemen Malern/ Tobia Stimmern und Christoff Maurern zu Zürich/ gerissen: Ytzt aber/ zu mehrerer Belustigung/ mit Teutschen Reimen geziehret vnd erklehret. Getruckt zu Straßburg/ bey Johann Carolo. Anno 1605:
Seltsamerweise enthält das Buch 1605 – abgesehen von fünf Bildern aus demjenigen von 1580 – zu Beginn weitere sechs Bilder im gleichen Stil; eines davon (zum Thema Ackerbau) mit dem Kombinationsmonogramm von Tobias Stimmer und Christoph Murer. Die weiteren Bilder unterscheiden sich davon, sind weniger komplex; zwei ebenfalls signiert mit dem Monogramm TS CM. Verdacht: Wenn es im Titel heißt Weiland [einst] von den beyden Berühmten vnd Fürnemen Malern/ Tobia Stimmern und Christoff Maurern zu Zürich/ gerissen: Ytzt aber – lagen diese Druckstöcke auf Lager und es wurden 1580 nicht alle verwendet, dann aber 1605? Die Lebensdaten: Tobias Stimmer (1539–1584); Christoph Murer (1558–1614). Fünftes Beispiel: Johannes Geiler von Kaysersberg (1445–1510) hielt 1508 in Straßburg 41 Predigten zur Fastenzeit, in denen auch Von den hexen vnd unholden die Rede ist. (Es gibt auch solche zum wütenden Heer, zu wilden Mannen, Werwölfen, Gespenstern.) Eine wird mit einem entsprechenden Bild illustriert, das allerdings nicht präzis auf den Text eingeht:
Das Bild erscheint auch in Drucken des Buchs von Johannes Pauli, O.F.M. (nach 1450 – um 1520) zum Thema Von den zauberern:
Sechstes Beispiel: Im Atelier von Christian von Mechel (1737–1817) wurden Bilder "abgekupfert" für die Verwendung in Bibeln: hier Ovids "Diluvium universale" (Metamorphosen I, 240ff.) für die Geschichte der Sinflut (1.Mos 7.21).
|
||
Übernahme von identischen Bildern in einen anderen KontextDabei kann sich sich die Aussage, die Pointe des Bilds ändern; es illustriert im neuen Kontext ggf. etwas anderes. Erstes Beispiel: Vom Flugblatt in die Kosmographie In einem 1499 publizierten Flugblatt mahnt Sebastian Brant († 1521) zum Frieden im sog. ›Schwabenkrieg‹. Es ist eine Bild-Text-Kombination; der Text ist in einer lateinischen und einer deutschen Fassung überliefert. Der Text ist einerseits ein Klagegesang des Gottes Janus, der eine Personifikation des Friedens darstellt – der Kriegsgott Mars verteidigt seine Ansicht. (N. Henkel hat die dt. Fassung transkribiert.) Wir konzentrieren uns auf das Bild auf der linken Seite des Blatts. Janus sagt von sich (Zeile 39f.): Ich Janus was zuo Rom bekannt | den Got des fridens man mich nant | ein krantz von ölboum ich all frist | Truog/ das des fridens zeichen ist … Der doppelgesichtige Janus mit den Attributen Stab und Schlüssel und seiner Eigenschaft als Sender des Friedens basiert auf Ovid, »Fasti« I, 89–144. Die Bedeutung Janus als eines Friedensbringers wird auch erwähnt bei Macrobius, »Saturnalien« I, ix, 2: Mythici referunt regnante Iano omnium domos religione ac sanctitate fuisse munitas. Im Bildhintergrund erkennt man pflügende und eggende und Schafe hütende Bauern. Darauf lässt sich die Klage des Janus (Vers 6ff.) beziehen: Min äcker ligen wuest on buw | Min pflueg zerbrochen vnd geschant | Min schüren/ hüser synt verbrant | Dar jnn ich samlet win und korn … Freilich sind die Bauern sehr tüchtig bei der Arbeit dargestellt, ohne zerbrochenen Pflug. — Im lat. Text wirft Pax dem Mars vor, Pflugscharen zu Schwertern umzuschmieden; eine Umkehrung des biblischen Zitats: (Die Völker) "werden ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden" (Jesaias 2,4). Darauf könnte sich das Bilddetail beziehen. Der neben Janus stehende Mercur mit dem Caduceus in der Hand und Flügelschuhen kommt im Text nicht vor. Er ist ebenfalls ein Friedensstifter: Er sieht einmal zwei kämpfend ineinander verschlungene Schlangen und schlägt mit der Rute, die er von Apoll geschenkt bekommen hatte, zwischen sie, damit sie sich trennen; so ist dieser Stab zum Symbol des Friedens geworden (Hyginus, »De Astronomia«, II, vii, 2). – Die ebenfalls im Text nicht vorkommenden Musikanten könnten allenfalls für ›Harmonie‹ stehen.
Sebastian Münster (1488–1552) verwendet den Holzschnitt in seiner »Cosmographie« (1544), und zwar zu Beginn des Kapitels Wie Italia zum ersten ist besessen worden/ vnd wo jim der nam härkompt. Da heißt es, dass Janus im Goldenen Zeitalter nach Italien gekommen sei. Er leret die menschen/ wie man wyn vnd frucht pflantzen solt/ vnnd daruon opffern solt … Der hinter Janus wachsende Rebenstock und die auf dem Feld arbeitenden Bauern bekommen hier einen anderen Sinn! S.Münster gibt als Quelle an Fabius Pictor (ca. 254 bis ca. 201). – Die Vorstellung von Janus als des Kulturbringers in Italien geht zurück auf Plutarch, »Fragen über römische Gebräuche«, Kap. 22, wo damit sein Doppelgesicht erklärt wird: Er war von griechischer Abkunft und setzte nach Italien über, wo er eine andere Sprache annahm und die wild und gesetzlos lebenden Bewohner zum Ackerbau und zur Annahme bürgerlicher Einrichtungen bewog.
Anhang: Seltsamerweise erscheint in einer der vielen Ausgaben von Johannes Lichtenbergers »Prognosticatio« eine Kopie des Bilds, ohne ersichtlichen Textzusammenhang:
Literaturhinweis: Nikolaus Henkel, Ein unveröffentlichtes deutsches Flugblatt Sebastian Brants: Die Klage des Friedens gegen den Krieg und die Verteidigung des Krieges gegen den Frieden (1499), in: Rudolf Bentzinger (Hg.), Grundlagen: Forschungen, Editionen und Materialien zur deutschen Literatur und Sprache des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Stuttgart: Hirzel 2013, S. 523–534. > https://freidok.uni-freiburg.de/data/9886 Erweitert in: Nikolaus Henkel, Sebastian Brant. Studien und Materialien zu einer Archäologie des Wissens um 1500. Verlag Schwabe 2021; Kapitel 11.4. = S. 557–569. Zweites Beispiel: Von Vergil 1502 zu Livius 1507 In Sizilien veranstaltet Aeneas Totenspiele für seinen Vater Anchises: eine Ruderregatta, einen Laufwettbewerb, einen Faustkampf, Bogenschießen und zuletzt das sog. Trojaspiel der Jugend, einen Scheinkampf mehrerer Reiterformationen, eher eine Aufführung als einen Wettkampf (Vergil, Aeneis, 5. Buch, Verse 545ff.). Diese Spiele illustriert einer der unbekannten Meister von Sebastian Brants Vergilausgabe 1502; hier das Turnier:
Der hochverdiente Drucker und Verleger Johannes Grüninger (um 1455 bis um 1533) in Straßburg, der die Vergilausgabe herausgebracht hatte, besitzt diese Druckstöcke und verwendet sie in weiteren Büchern; oft ziemlich wahllos. 1507 druckt er eine deutsche Übersetzung der Römischen Geschichte von Livius (nicht zu verwechseln mit der 1505 in Mainz bei Johann Schöffer erschienenen Livius-Übersetzung, aus der Grüninger ebenfalls Bilder entnommen oder kopiert hat). Livius, ab urbe condita I, 24ff. schildert, wie es im Krieg der Albaner gegen die Römer zu einem stellvertretenden Zweikampf auserwählter Helden kommt: Curatier (Alba) kämpfen gegen Horatier (Rom). Grüninger übernimmt das vollkommen anders intendierte Bild aus dem Vergil, er lässt lediglich bei den Tituli der Helden einige Buchstaben entfernen (z.B. oben rechts stand ENEAS, jetzt: E E S):
Grüninger hat viele Druckstöcke wiederverwendet; dies ist kaum erforscht. Drittes Beispiel: Der Verleger Schöffer verwendet Bilder aus der Livius-Ausgabe von 1505 (vgl. oben zur Kombination von Teilbildern) drei Jahre später wieder in der Bambergischen Halsgerichtsordnung, wo sie inhaltlich einigermaßen hinpassen; die Textsorte ist freilich eine andere: Geschichte / Strafprozessordnung. Die Bildkombination ›Richterspruch / Gang ins Gefängnis‹ erscheint in der Livius-Ausgabe vier Mal: Fol. XLV verso – LXXVI recto – CLIX recto – CCCLXVI recto.
Viertes Beispiel: 4 x Hausbau Petrarcas Buch »de remediis utriusque fortunae« wurde von Peter Stahel und Georg Spalatin ins Deutsche übersetzt, und dabei wurde systematisch jedes Kapitel mit einem Holzschnitt versehen; es sollte 1521/22 erscheinen. Als Initiatoren des Buchprojekts gelten die Verleger Grimm und Wirsung in Augsburg. Dieser Verlag ging 1525 in Konkurs. Die Druckstöcke und das Typenmaterial des Projekts fanden ihren Weg über die Verpfändung ungefähr 1527 in die Druckerei des Gläubigers Heinrich Steiner/Steyner in Augsburg. 1532 wurde es endlich unter dem Titel »Von der Artzney bayder Glück, des guten und widerwertigen« gedruckt; 1539 erneut mit neuer Übersetzung.
Es scheint offensichtlich, dass die Druckstöcke für das Buch von Petrarca angefertigt wurden (vgl. hierzu das Kapitel auf dieser Website). Das hinderte den geschäftstüchtigen Verleger Steyner nicht, sie bereits vor dessen Drucklegung in anderen Publikationen zu verwenden, und später wieder. ••• Im ersten Teil des Buchs »Von der Artzney bayder Glück«, Kapitel CXVIII geht es um den Ruhm einer üppigen Bautätigkeit. Die Personifikation der Freude jubelt: Ich hoff ehre von dem gepew [Gebäude]; Ich berayt myr ein Glori mit pawen; und ähnlich. Die Vernunft wendet dagegen ein: Ich hab nicht gewißt/ das man mit kalck/ sand/ vnd höltzern/ auch staynen ehre suocht/ sonder glaubet das die durch wol gehandelt sachen vnd tugenden ersuocht vnd erlangt wurd. Alle Dinge von Menschenhand sind hinfällig, was von Menschenhand geschaffen worden ist, kann auch von Menschenhand wieder zerstört werden. Das wird mit Beispielen aus der Geschichte verdeutlicht: Troja, Babylon, der goldene Palast von Nero usw. Der moralische Diskurs wird 1539 so zusammengefasst:
Das Bild zeigt den Bauherrn in Rückenansicht, der mit einer Stange Anweisungen gibt; vor ihm ein Steinblock, der bearbeitet wird; der Steinmetz hat sich abgewendet und schaut ebenfalls zum Haus. Im Hintergrund das halbfertige, eingerüstete Haus mit Arbeitern am Werk. ••• Bereits 1531 publiziert Steyner die deutsche Übersetzung von Ciceros »de officiis«:
Dasselbe Bild illustriert hier (Fol.XXXIIIr) eine andere Moral (Textgrundlage: Cic., de off. I, 138–140): Ein Haus soll dem Gebrauch und der Würde des Besitzers angepasst sein; man soll dafür sorgen, dass das Haus wegen der Würde des Besitzers gelobt wird und nicht umgekehrt der Besitzer wegen der Pracht des Hauses (ornanda enim est dignitas domo, non ex domo tota quaerenda, nec domo dominus, sed domino domus honestanda est); die Größe des Hauses soll angemessen sei ; man soll sich mit dem Hausbau nicht ruinieren; Beispiele von römischen Hausbesitzern. Vor schand vnd schad dem billich grawt/ Der vber sein vermügen bawt. Die zier im hauß ist aller best/ Findt man darinn frum wirt vnd gest. ••• Im selben Jahr 1531 publiziert Steyner die deutsche Übersetzung des spätantiken Geschichtswerks von Marcus Iunianus Iustinus: »Epitoma Historiarum Philippicarum« mit Bildern von Jörg Breu d.J. und des Petrarcameisters (Musper L 118):
Hier ist der Kontext desselben Bildes (Fol. LXII verso) der: Von der statt Carthago/ wann vnd von wem die erpawen ist. – Dieweil man yetzund an die stat carthago kommen/ ist billich etwas von jrem vrsprung zusagen/ … Erzählt wird hier auch die Gründungslegende Karthagos. Die phönizische Königin Elissa (später Dido genannt) ist vor ihrem Bruder (der ihren Gatten ermordet hatte) auf einem Schiff geflohen und an der afrikanischen Küste gelandet. Sie erbittet vom dortigen Herrscher so viel Land, wie sie mit einer Ochsenhaut umspannen könne. Das wird ihr bewilligt. Dido lässt die Haut in feine Riemen schneiden, legt sie aneinander und kann so ein großes Stück Land umziehen. Darauf lässt sie dort eine Festung erbauen (phönizisch Carthada ›Neustadt‹): Karthago. Genau genommen müsste als Erbauerin der Stadt eine weibliche Figur dargestellt sein. Die Szene hat der Illustrator der Livius-Übersetzung 1505 gezeichnet, sogar mit der Szene des Zerschneidens der Ochsenhaut. Romische Historie / Uß Tito Livio gezogen. Mentz: Schoffer, 6. März 1505. Fol. XCI verso:
••• 1537 verlegt Steyner eine deutsche Übersetzung von Polydorus Vergilius, »de inventoribus rerum« (darüber mehr unten). Im dritten Buch, Kapitel 7 ist das Thema Vom vrsprung der Bawmayster. Er entwirft einen kleinen kulturgeschichtlichen Abriss; darunter: Etlich habendt jhnen heüser von blettern gemacht/ etlich habend hölern vnden an den bergen hinein gegraben … Dann aber haben die Menschen dank ihres Verstands gelernt, Häuser zu bauen: die wänden mit auffgerichten spreussen/ vnd zwischen gelegten stauden mit laim zu vermachen/ auch laymine knollen zuo dörren/ vnd auff einander zuo setzen. Dann folgt die Architectura, die der abgöttin Pallas und dem alttestamentlichen Jobal [?] zugeschrieben wird. (Details folgen dann im nächsten Kapitel, wiederum mit einem Holzschnitt des Petrarcameisters). Das Bild mit dem Steinmetzen passt nicht stimmig zum Text des Kapitels:
Literaturhinweis hierzu: Theodor Musper, Die Holzschnitte des Petrarkameisters. Ein kritisches Verzeichnis mit Einleitung und 28 Abbildungen, München: Verlag der Münchner Drucke 1927. (Bild Nr. 180) Fünftes Beispiel: Von der technischen Illustration zur Illustration einer Geschichte Zur Bestimmung von Weglängen haben die antiken Bematisten (Schrittzähler) – mechanische Messwagen (Hodometer) verwendet. Vitruv schildert den Mechanismus eines solchen mechanischen Wegmessers sehr genau (»de architectura« X, ix > lat. Text | engl. Übersetzung) Das Prinzip ist dieses: Mittels eines vom Rad des Wagens getriebenen Untersetzungsgetriebes wird eine Scheibe bewegt, in welche Löcher eingebohrt sind, in denen sich kleine Steine befinden, die nach und nach in einen Kasten fallen. Nach beendigtem Weg zählt man die Steinchen und kann, weil man das Maß der Übersetzung kennt, ganz einfach den zurückgelegten Weg messen. Walther Ryff zeigt in seiner Vitruv-Übersetzung eine Rekonstruktions-Zeichnung (Ausgabe Nürnberg: Petreius 1548 > UB Heidelberg)
Spätestens 1575 hat Sebastian Henricpetri diese Vitruvausgabe nachgedruckt und ist so in den Besitz der Holzstöcke gelangt: Vitruvius, Des aller namhafftigisten unnd hocherfarnesten, roemischen Architecti, unnd kunstreichen Werck oder Bawmeysters, Marci Vitruvii Pollionis, zehen Buecher von der Architectur und kuenstlichem Bawen[…] erstmals verteutscht, unnd in Truck verordnet, durch, D. Gualtherum H. Rivium […], Getruckt zu Basel durch Sebastian Henricpetri, im Jar nach der Geburt Christi 1575. In der Ausgabe 1588 (evtl. schon 1578?) verwendet Sebastian Münster (1544–1628) bzw. sein Verleger dasselbe Bild in einer Auflage der »Cosmographey« für einen ganz anderen Zweck. Er beschreibt den prachtvollen Feldzug Alexanders des Großen nach Cilicien. Mehrere mit Silber und Gold gezierte Wagen werden geschildert, dann des Königs Wagen. Usw. Darnach kamen zwen Wägen/ vnd saß in einem des Königs Mutter/ im andern sein Gemahel. — Da hatte er Glück, ein Bild mit Frauen in einem Wagen zu finden, das halbwegs passte...
Sechstes Beispiel: Aus geographischen Beschreibungen in eine Prodigiensammlung • In der lateinischen Ausgabe der Cosmographie des Sebastian Münster (1488–1552 in Basel) aus dem Jahre 1550 steht ein Wimmel-Bild mit der Fauna im Kapitel über Indien: De animalibus, quæ gignit India, & primum de elephanto. (Die von Viktor Hantzsch, Leipzig 1898, angegebene lateinische Ausgabe aus dem Jahre 1544 war mir nicht zugänglich; möglicherweise war das dort schon so.)
• In der deutschen Ausgabe der Kosmographie 1553, illustriert dasselbe Bild die fruchtbarkeit des alten Teütschen erdtrichs, die schon Tacitus schildere:
Dass es im alten Teütschen erdtrich Elefanten und Nashörner gegeben hat, glaubte wohl selbst Sebastian Münster nicht (bei einem Einhorn ist das was anderes). Vielleicht hat dieses Bild seinerseits Vorfahren. Es mag die Tiere in der Schöpfung illustriert haben oder den Tierfrieden (Jesaias 11,6–8 und 65,25). Oder es stammt aus einem ethnographischen Werk wie z.Bsp. Wahrhafftige Historische Beschreibung dess gewaltigen Goltreichen Königreichs Guinea, […] an Tag geben durch Johann Theodor und Johann Israel von Bry, 1603 > hier. • Johannes Herold – (1514–1567; seit 1539 in Basel), ein ausgezeichneter Kenner der Antike, der im selben Verlag publiziert – benutzt das Bild 1554 in seiner Übersetzung von Diodorus Siculus, wo dieser von den Indiern und jren Anstössen den Scythiern berichtet. Hier passt wenigstens der Elefant. (Zum Kampf zwischen Nashorn und Elefant mehr hier.)
• Conrad Lycosthenes (1518–1561) hat eine Sammlung von ›Prodigia‹ zusammengestellt, das sind extraordinaire Ereignisse (Missgeburten bei Tieren und Menschen; Kometen; Schriften auf Naturdingen; sonderbare Regen u.a.m.), die oft als Vorzeichen (für politische Wirren und Kriege; Missernten, Hungersnöte; Pest u.a.m.) gewertet wurden.
Vor dem Jahr 87 vor Chr. ist das Thema der Bundßgnossen krieg wider die Römer: do lüeffen alle thier/ so dem mentschen heimblich vnd nutzlich/ als Hund/ Pferd/ Esel/ Rinder / Schaff/ Säw/ vnd ander vieh zusammen/ wurden wild/ rissen sich auß/ lieffen zuowald/ liessen sich weder anrüeren noch handlen … Nur in der deutschen Übersetzung von Johannes Herold findet sich dazu dieses Bild – er hat den Druckstock offenbar bei der Arbeit in der Offizin entdeckt und sogleich inseriert:
Siebtes Beispiel: Aus der Bibel in die Oenologie und die Baukunst In der Chronik von Johann Stumpf (1547) wird der Reichtum an Reben und Wein im Veltlin (damals als zugewandter Ort zur Eidgenossenschaft gehörig) gepriesen:
Irgendwie kommt einem diese Szene doch bekannt vor! Es ist eine Illustration zur Geschichte aus dem 4.Buch Moses (Numeri), Kap. 13, wo die zur Erkundung Kanaans ausgeschickten Botschafter im Traubental eine Rebe abschneiden und zu zweit an einer Stange tragen:
Auch bei der Darstellung der Errichtung des Straßburger Münsters dient die Zürcher Bibel von 1531 als Bilder-Vorrat. Dort illustriert das Bild den Turmbau von Babel (Genesis 11): Achtes Beispiel: Aus der Bibel aufs Titelblatt eines technologischen Werks Leonhard Fronsperger († 1575) verfasste ein Buch zur Architektur. Was passt besser (?), als den Bau des Turms zu Babel aufs Titelblatt zu setzen:
Das Bild stammt aus der im selben Verlag und im selben Jahr gedruckten Bilderbibel. — Es störte offenbar nicht, dass ausgerechnet dieses die Hybris der Menschen aufzeigende und dem HErrn nicht wohlgefällige Bauwerk (vgl. Genesis 11, 1–11) als Titelbild eines Buch zur Baukunst verwendet wird, von dem es heißt, es sei Allen Oberkeiten vnd Underthanen nütz vnd dienstlich zu gebrauchen.
Neuntes Beispiel: Vom ›Kriegsrechtsbuch‹ in eine Enzyklopädie Ein Narrativ, das sich lange hält, besagt, es gebe einen Stifter oder Erfinder von Riten, Techniken, Sitten. Plinius d.Ä. (gest. 79 AD) kommt im siebten Buch seiner Naturkunde (naturalis historia VII, lvii, 191–209) auf die Idee, darzulegen, was einzelne Menschen erfunden haben; es folgt ein Sammelsurium von Techniken und Praktiken, die auf ihre Urheber zurückgeführt werden. In VII, lvii,192f. geht es um die Erfinder der Schrift. Der Herausgeber von Caij Plinij Secundi / Des furtrefflichen Hochgelehrten Alten Philosophi / Bücher und schrifften / von der Natur / art vnd eigentschafft der Creaturen oder Geschöpffe Gottes […], Frankfurt: Sigmund Feyerabend 1565 (Seite 74) braucht ein Bild, wo das Schreiben irgendwie thematisch ist: Er ist nicht in Verlegenheit – in seinem Verlag erscheint im selben Jahr ein von Jost Amman bebildertes Buch, in dem eine entsprechende Szene gezeigt wird: Der Gerichtschreiber am Werk. (Das Bild wird hier mehrfach verwendet.)
Zehntes Beispiel: Vom Fechtbuch quer in die Enzyklopädie Hier ist Feyerabend der deutschen Übersetzung aufgesessen. Plinius beschreibt (naturalis historia VII, xlviii, 152) den häufigen Olympiasieger Eythymos, der ein pycta (Faustkämpfer) gewesen ist – dies übersetzt Johannes Heyden mit Fechtmeister. Und so entnimmt der Herausgeber das Bild einer berühmten Fechtschule:
Elftes Beispiel: Vom Neuen Testament ins Kochbuch 1571 erscheint eine Bilderbibel mit Holzschnitten von Jost Amman (1539–1591). Darin die Illustration der Rede von Jesus über den reichen Mann und den armen Lazarus (Lukas 16,19–31) mit dem Text: Schlemmers Parabel thut vns lehren/ das wir vns zeitlich sölln bekehren.
1581 erscheint beim selben Verleger ein Kochbuch, wo dasselbe Bild – doch ziemlich schräg und unverschämt – verwendet wird für die Illustration der Bankette von Adligen. Nun folgen vier Bancket der Ertzhertzogen/ darinn vermeldet/ was für Speiß vnd Trachten [Gerichte] nicht allein auff die Fleisch- / sondern auch auff die Fasttage zuzurichten seyen.
Zwölftes Beispiel: Noch ein ›Kochbuch‹ Cicero sagt in seinem Buch vom pflichtgemäßen Handeln (de officiis I, 152–161), dass von den vier ehrenhaften Dingen (Erkenntnis, Gemeinschaft, Grossmut, Mäßigkeit) die Gemeinschaft das höchste Gut ist. Das begründet er ausführlich und schreibt dann: Die Menschen bilden nicht einfach aus Notwendigkeit eine Gemeinschaft, sondern deshalb, weil es ihrer Natur entspricht; selbst wenn der Mensch alles Nötige fürs Überleben hätte und dadurch nicht auf andere angewiesen wäre, würde er noch Gesellschaft suchen.
In der Übersetzung von Johann von Schwarzenberg wird das Motiv der Bienen im Bild aufgenommen:
Das Einzelgängertum wird bei Cicero nicht explizit behandelt. Der Illustrator stellt neben die Bienenkörbe eine einzelne Elster in einem Käfig.
Dasselbe Bild übernimmt H.Steiner in der deutschen Übersetzung des Stephan Vigilius von Bartolomeo Sacchi (1421–1481), »De honesta voluptate et valitudine« [erster Druck 1474] – das ist nicht einfach ein Kochbuch, sondern eine humanistische Abhandlung über die Nahrungsmittel und ihre diätetischen Eigenschaften, ein Regimen sanitatis. Hier ist im 2. Buch, 13. Kapitel Von dem Honig die Rede; insofern sind die Bienenkörbe am Platz, die Elster freilich nicht.
|
||
Übernahme in einen neuen Kontext, wo das Bild besser passtBis jetzt war immer die Rede von Translokationen in Kontexte, wo das Bild nur notdürftig hinpasst. Gelegentlich scheint das Umgekehrte der Fall. Erstes Beispiel: In der deutschen Übersetzung des antiken Geschichtsschreibers Marcus Iunianus Iustinus erscheint zweimal ein (Jörg Breu d.J. zugeschriebener) Holzschnitt bei der Beschreibung von Städte-Gründungen (Fol. IX recto Athen und CXVII verso Hyspanien). Insofern solche Geschichten meist einen agrarischen Ursprung annehmen, ist das Bild einigermaßen sinnvoll.
Der Holzschnitt dient dann im Polydor-Vergil-Buch (3.Buch, 2.Kapitel) – besser passend – zur Illustration der Frage
Zweites Beispiel: In der mit Holzschnitten des Petrarcameisters illustrierten Cicero-Übersetzung von 1531 fragt man sich öfters, ob ein Bild wirklich für genau diesen Textabschnitt eine Illustration darstellt. – Es gibt 36 Holzschnitte, die in Cicero 1531 und in Petrarcas Glücksbuch 1532 erscheinen, in ganz anderen Kontexten. Dies zu untersuchen wäre ein interessantes Forschungsvorhaben. Hier das Bild zur Textstelle, wo Cicero sagt (de officiis I, xviii, 60), dass weder Ärzte noch Feldherren noch Redner – mögen sie auch die Vorschriften ihres Fachs verstanden haben – etwas Lobenswertes erreichen können (quicquam magna laude dignum … consequi possunt) ohne Erfahrung und Übung (sine usu et exercitatione), denn die Bedeutsamkeit der Sache erfordere auch Erfahrung und Übung (sed rei magnitudo usum quoque exercitationemque desiderat). Johann von Schwarzenberg (1463–1528) übersetzt: Wann die größ vnd höhe der gebürlichen werck/ würckung/ gebrauchung/ vnd übung erfrodert. Dass ein Maler – nicht im Text vorkommend ! – gebrauchung/ vnd übung nötig hat, ist klar. Die Verse über dem Bild zielen auf eine andere Aussage. Schwarzenberg hat den Akzent verschoben von der Notwendigkeit der Übung zur Geringachtung einer Kunst bzw. Philosophie, die ohne Wirkung bleibt.
Sehr passend verwendet dann der Redaktor der deutschen Plinius-Ausgabe diesen Holzschnitt, wo es um die Erfindung der Malerei geht (naturalis historia VII, xxxix, 126):
|
||
Ein Fall von bunter Kompilation: Die Bilder in Polydorus Vergilius 1537Plinius legt im VII. Buch seiner Naturkunde (hist. nat. VII, lvii, 191–209), nachdem er die Natur des Menschen besprochen hat, dar, was einzelne erfunden haben (quae cuiusque inventa sunt); es folgt ein Sammelsurium von Techniken und Praktiken, die auf ihre Urheber zurückgeführt werden. Polydorus Vergilius (* um 1470; † 1555) hat diese Überlegung (er zitiert Plinius im Vorwort) zum Prinzip des Artikelaufbaus seiner Enzyklopädie »de inventoribus rerum« (1499 / 1521) gemacht. Eine illustrierte deutsche Übersetzung erscheint 1537 bei Heinrich Steiner in Augsburg: Polydorus Vergilius Urbinas, Von den erfyndern der dingen. WIe und durch wölche alle ding / nämlichen alle Künsten / handtwercker / auch all andere händel / Geystliche und Weltliche sachen [...] von anfang der Wellt her / biß auff dise unsere zeit geübt und gepraucht [...] durch Marcum Tatium Alpinum grüntlich / vnd aufs fleissigst jnns Teutsch transferiret unnd gepracht / mit schönen figuren durchauß gezyeret, / jedem Menschen nutzlich und kurtzweylig zuo lesen. Augspurg: Heynrich Steyner MDXXXVII. Digitalisat > http://diglib.hab.de/drucke/q-49-2f-helmst/start.htm Wenn man nur schon eine Auswahl von Kapiteltiteln überfliegt und dazu das Bestreben Steiners stellt, jedes Kapitel mit einem Bild zu versehen, ermisst man die Schwierigkeit des Unternehmens 1537:
Das Buch ist voll von Bild-Übernahmen; das lohnte eine längere Untersuchung. Vgl. die Skizze von Paul Michel, Habent sua fata picturæ. Rezyklierte Bilder in Büchern des 16.Jahrhunderts, in: LIBRARIVM, Zeitschrift der schweizerischen bibliophilen Gesellschaft 2019, Heft I, S. 26–39. Vgl. die bereits bei Musper (unter L 154) nachgewiesenen Bilder des Petrarcameisters. Theodor Musper, Die Holzschnitte des Petrarkameisters. Ein kritisches Verzeichnis mit Einleitung und 28 Abbildungen, München: Verlag der Münchner Drucke 1927. Erstes Beispiel A: Ein inhaltlich gut passendes Bild des Petrarcameisters H.Steiner ist der Herausgeber des 1532 erschienenen Buchs Franciscus Petrarcha, Von der Artzney bayder Glück / des guten vnd widerwertigen […]. Augspurg: H. Steyner MDXXXII > http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00084729/image_1 Selbstverständlich bedient er sich für spätere Bücher aus diesem Werk. Wenn Vergilius Polydorus (II,9) das Thema der Erfindung der Mnemotechnik abhandelt (Wer erstlich der Gedächtnuskunst angezeygt/ oder derselbigen ein lob erlangt habe), passt dazu perfekt das Bild aus Petrarca, 1. Buch, Kapitel 8: Von der gedechtnus.
Erstes Beispiel B: Ein mindestens hinsichtlich des gezeigten Gegenstands passendes Bild des Petrarcameisters Erzwungen ist der Beizug eines Bilds zum Thema , wo Vergilius Polydorus von der Erfindung des Spiegels handelt (II,20): Vonn wem der erst Guldin pfenning erfunden/ oder wer das Sylber/ vnd Ertz zuo Müntz geschlagen/ auch ein Sylberin Spiegel gemachet habe. Das Bild steht in Petrarcas Glücksbuch(1532) im Kapitel Von fürtrefflicher gestalt des leibs (1. Buch, 2.Kapitel), wo die Personifikation der Freude jubiliert: Meins leibs hübsche ist fürnem usw. Das Bild zeigt eine Dame, die sich stolz in einem Spiegel beschaut, daneben schlägt ein Pfau das Rad – eine alte Allegorie der Superbia. Zweites Beispiel: Ein völlig unpassendes Bild des Petrarcameisters In Buch I, Kapitel 15 äußert Freude ihre Genugtuung darüber, dass sie ein treffliches Vaterland hat. Die Vernunft gibt zu bedenken, auch in einem prächtig ausgestatteten Vaterland sei es entscheidend, dass darin tugendhafte Bürger leben. Was soll einem das Licht des Vaterlands leuchten, wenn er selber finster ist? Das Vaterland an sich macht seine Söhne nicht edel; als Beispiel dienen u.a. der Verräter Catilina und Kaiser Caligula. Als positive Figur wird u.a. genannt Marcus Porcius Cato (Uticensis). Das Bild zeigt vorne links einen gekrönten Mann, der von einem anderen erschlagen wird; es könnte die Ermordung Caligulas durch einen Prätoriangardisten darstellen. Vorne rechts ist ein in ein Soldatengewand gekleideter Mann abgebildet, der sich mit dem Schwert selbst entleibt; es könnte Cato gemeint sein, der sich nach der Schlacht das Leben nahm. (Weitere Elemente im Hintergrund sind schwer zu deuten).
Ebenso unpassend wurde das Bild in der Cicero-Übersetzung eingefügt, zur Stelle de officiis III, 46–47, wo gesagt wird: Es wird oft des scheinbaren Nutzens wegen Grausames begangen, doch Grausamkeit ist die Feindin der menschlichen Natur und kann nie nützlich sein; die Selbsttötungen ergeben keinen Sinn. Officia M. T. C. Ein Buch / so Marcus Tullius Cicero der Römer / zuo seynem sune Marco. Von den tugentsamen ämptern in Latein geschriben. Augsburg: H. Steyner MDXXXI; Fol. LXXII recto
Drittes Beispiel: Ein inhaltlich gut passendes Bild aus einem anderen Verlag Im 2. Buch, 18. Kapitel ist davon die Rede Vom aller ältesten herkommen der gesälben/ vnd wann erstlich die Gesälben zuo Rhom erkennt seyen worden. Das Bild dazu (Fol. LVIII verso): Der Druckstock ist entnommen einem ebenfalls in Augsburg erschienenen, älteren Buch, in dem ebenfalls die Herstellung von Salben thematisch ist: Hieronymus Brunschwig, Dis ist das Buch der Cirurgia. Hantwirckung der Wund Artzney, Augspurg: Schönsperger 1497. Digitalisate > http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00026481/image_4 > http://diglib.hab.de/inkunabeln/53-med-2f/start.htm Den Holzschnitt hat schon der (unbekannte) Herausgeber des Buchs über die Sünden des Munds von Johannes Geiler von Kaysersberg verwendet: Der Prediger fasst die Sünden des Munds (fressen, lügen, Gott lästern, schmeicheln, schelten, sich rühmen, leere Wörter schwatzen usw.) auf als Blasen/Geschwüre (blatern), gegen die er jeweils eine Salbe, d.h. eine Tugend verschreibt. Eine der letzten Predigten spricht dann von den Salben allgemein; dazu das Bild.
Viertes Beispiel: Griechen oder Mohammedaner? Aus Breydenbach Ein Kapitel in Bernhard von Breydenbachs Buch der Reisen ins heilige Land (Erstausgabe Mainz 1486) ist der dort ansässigen multinationalen Bevölkerung gewidmet. Dazu bringt er ein Bild mit der Überschrift (in der deutschen Übersetzung 1505): Von den kriechen, deren auch vil zuo jherusalem sind / auch wie sy geen in jren klaideren vindest du hernach.
In der Ausgabe des Polydorus Vergilius gibt es ein Kapitel Vom ersten vrsprung der Mahometischen Secten (VII, 8). H. Steiner illustriert das mit dem Bild aus Breydenbach. Es ist ein handwerklich guter Nachschnitt des Bilds aus der lateinischen Ausgabe; die Textteile sind weggelassen. Das Thema des Kapitels ist der pestilentzischen Mahometisch secten anfang und deren bößwichtische geystligkeyt. Der griechische Mönch in der Kutte rechts wird somit wohl zu einem Mohammedaner umgedeutet, oder zu Mohammed selbst. Allenfalls könnte man die Figur auch mit dem im Text erwähnten Häretiker Sergius assoziieren, einem syrischen Mönch, der als Lehrer Mohammeds galt.
Fünftes Beispiel: Simon Magus aus dem Fortunatus Im 8. Buch, 3. Kapitel behandelt Polydorus Vergilius den Ursprung der Häresie. Der Erz-Häretiker ist Simon Magus (vgl. Apostelgeschichte 8,9–25), deshalb ist das Kapitel betitelt Von vrsprung der Symoneischen secten. Der Text folgt dann der Erzählung der Legenda Aurea (im Kapitel über den Apostel Petrus; Übersetzung von Richard Benz, Heidelberg 1955, S. 432), wo vom Wettkampf zwischen dem heiligen Petrus und dem Zauberer Simon Magus in Rom berichtet wird: Um zu beweisen, dass er Gott wohlgefällig sei, unternimmt es Simon, auf dem Capitol in die Luft zu fliegen. Do flog der Simon von der Erden schon dahin. Aber Petrus betet zu Gott, die Engel mögen den Simon fallen lassen; das geschieht.
Um den Flug Simons zu illustrieren, bedient sich H.Steiner eines Bilds aus dem ›Volksbuch‹ »Fortunatus«. Hier wird geschildert, wie der Held dem Sultan ein wünschhüetlin entwendet, das die Eigenschaft hat, den Träger dorthin zu tragen, wo er gerade sein möchte (Hans Gert Roloff, Fortunatus, Stuttgart: Reclam 1981 = RUB 7721, S.112). In einem späteren Kapitel wird gezeigt, wie ein Sohn des Helden mit dem Hütlein fliegt (a.a.O. S.145f.) Die erste Ausgabe des »Fortunatus« erschien 1509: Wie ain iüngling geporen auß dem künigreych Cipern/ mit namen Fortunatus in fremden landen in armuot und ellend kam, Augsburg: Johannes Heybler / Johann Otmar 1509 (mit Holzschnitten von Jörg Breu d.Ä.) – Digitalisat der BSB > http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00007945/image_160 Steiner ist offenbar an die Druckstöcke herangekommen, was seine Ausgabe zeigt: Von Fortunato vnd seinem Seckel auch Wünschhüetlin, Heinrich Steyner, Augspurg 1531. (Hans Gert Roloff weist in der Ausgabe S.324 noch drei weitere Ausgaben von Steiner bis 1544 nach.)
Sechstes Beispiel: Fasten oder Essen? Aus Ulrich von Richentals Konzilschronik Das 6. Kapitel des 6. Buches von Polydorus Vergilius handelt von der Erfindung des Fastens, vom Segnen der Mahlzeit und woher es kommt, dass man zum Essen aus heiligen Schriften vorliest. Das Bild erinnert an den Inkunabel-Druck der Chronik des Konstanzer Konzils des Ulrich von Richental:
H.Steiner veranstaltete 1536 eine Neuausgabe der Konzilschronik, in der die Bilder neu im modernen Stil gezeichnet sind. Das Bild hier veranschaulicht, wie beim Conclave in Konstanz (1414–1418) die wählenden Prälaten mit Essen versorgt wurden (Text: Fol. XLIIII verso); es wurde ihnen von Dienern an Stangen in gelten (Bottichen), in denen man sonst Kinder badet, herbeigeschafft; an der Stiege wurden diese von Rittern empfangen, die weiße Tücher über dem Schoß trugen; zwei Bischöfe sind im Raum anwesend; einer der beiden scheint einen Krug zu segnen. Die Figur mit dem großen Schlüssel mag symbolisieren, dass das Tor gut verschlossen ist. – Von Fasten und Tischlesung ist in der Chronik nicht die Rede. Man müsste freilich fragen, wie ein Bild aussieht, mit dem das Fasten visualisiert wird. Steiner hat eines beigezogen, auf dem wenigstens das Essen in einem religiösen Zusammenhang Thema ist.
Übrigens druckt S. Feyerabend dann 1575 die Konzilschronik nochmals und übernimmt dabei zum Teil Bilder aus dem Druck Augsburg 1536:
Siebentes Beispiel: Illustrierte Realität aus einem fiktionalen Text übernommen Polydorus Vergilius handelt im 1. Kapitel des 2. Buchs Von vrsprung des Rechtens/ vnd der Gesatzen/ auch wer am ersten den Menschen Gesatze hab gegeben.
Das Bild einer Gerichtsszene findet H.Steiner leicht im »Theuerdank«: »Theuerdank« ist eine von Kaiser Maximilian I. entwickelte Mixtur aus stilisierter Autobiographie, politischer Utopie und Panegyrikus zum eigenen Andenken. Der Text schildert im Kern die Brautwerbungsfahrt des Protagonisten zu Erenreich (gemeint ist Maria von Burgund), der sich vielerlei Hindernisse in den Weg stellen. Diese werden in Form der drei allegorischen Gestalten Fürwittig, Unfalo und Neidelhart dargestellt, die den Helden allerlei Gefahren aussetzen: Jagd- und Turnierunfälle, Lawinenunglücke, Einbruch auf zugefrorenem See, u.dgl. Der Held überwindet mit seinem treuen Begleiter Erenhold alle Gefahren. Im 109. Kapitel werden die drei Figuren, die dem Helden Kaiser Maximilian das Leben sauer gemacht haben, vor Gericht gestellt. Johannes Schönsperger hat den 1517 erstmals in Nürnberg erschienenen »Theuerdank« >http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00013106/images/ 1519 in Augsburg nachgedruckt (Neusatz mit den alten Typen; Holzschnitte übernommen) Die Druckstöcke sind dann offenbar zu H.Steiner gelangt, der 1537 einen Neudruck macht (mit gewöhnlicher Schwabacher-Typographie):
Bereits 1536 hat Steiner das Bild verwendet für die Illustration der Übersetzung des Trojanerkriegs von Dictys Cretensis / Dares Phrygius. Hier ist das Thema: Orestes wird in Athen vor Gericht gestellt, angeklagt, er habe seine Mutter umgebracht:
Achtes Beispiel: Vom Titelbild ins Innere des Buchs 1533 hat Steiner die Thukydides-Übersetzung von Hieronymus Boner (1490–1552) gedruckt. Das Titelblatt, das den Geschichtsschreiber bei der Arbeit zeigt, wird Jörg Breu d.Ä. († 1537 in Augsburg) zugeschrieben.
In der Polydor-Vergil-Ausgabe dient der Holzschnitt zur Illustration des Kapitels (1. Buch, Kap. 12) Wer erstlichen die geschichtbeschreybunge Hystoriam gemachet […]. Im Text selbst heißt es dann: Inn derselben sind bey den Gretiern der Thucidides/ Herodotus/ Theopompus berümpt gewesen […]. Insofern passt das Bild (Fol. XVII recto) gut: Der Holzschnitt wird dann wiederverwendet für die Ausgabe einer deutschen Übersetzung von Flavius Josephus, die 1552 bei Egenolff erscheint, der die Konkursmasse von Steiner erworben hatte:
Neuntes Beispiel: Polydor Vergil bringt in seiner Auflistung der Erfinder-Traditionen auch (3. Buch, 9. Kapitel, Fol. LXXXV verso): Wer die ersten Statt/ die Gemeüren/ die Türn [Türme]/ die Tabernackel/ die Chorkirchen gepawen/ oder am ersten Got dem Allmechtigen ein Tempel hab auff gericht/ oder die Galgprunnen ergraben habe. Zur Illustration findet er ein einleuchtendes Bild, das primitive Maurer-Arbeiten, das Errichten eines Hauses und eine bereits fertig erbaute Stadt zeigt: Es stammt aus Marinus Barletius, Des allerstreytparsten vnd theüresten Fürsten vnd Herrn Georgen Castrioten/ genañt Scanderbeg/ Hertzogen zu Epiro vnd Albanien etc. Ritterliche thaten/ so er zu erhalten seiner Erbland/ mit den Türckischen Kaysern in seinem leb... Augsburg: Steiner 1533, im Kapitel, das überschrieben ist mit: Wye Scanderbeg ain newes Castell auff dem berg Modrissum bawet/ den Türcken den eingang in Epirum zu weeren. Zehntes Beispiel: Hexen fliegen von Buch zu Buch Polydor Vergil befasst sich auch mit der Erfindung der Magie. Im 22. Kapitel des ersten Buchs ist die Frage:
Literaturhinweis: Judith Venjakob, Der Hexenflug in der frühneuzeitlichen Druckgrafik. Entstehung, Rezeption und Symbolik eines Bildtypus, Petersberg: Michael Imhof Verlag 2017. (Das hier gezeigte Bild wird im Buch nicht besprochen.) Elftes Beispiel: Szenen aus der Bibel Aus dem (seinerseits zusammengestoppelten) »Memorial der Tugendt« hat Steiner mehrere Bilder in das Polydor-Vergil-Buch hinübergenommen. Das Memorial beginnt mit biblischen Szenen, vom Ratschluss der Schöpfung bis zur Vertreibung der Wechsler aus dem Tempel. Mit einigen Ausnahmen tragen diese Holzschnitte das Monogramm von Hans (Leonhard) Schäuf(f)elein (ca. 1480–1540). Die Entstehung des Opfers bringt Polydor im 5.Buch, 7. Kapitel: Vom ersten vnd seer alten prauche zuo opfferen bey den Juden/ Auch von auffmerckung der Feyertägen/ und fürnemen die Kirchen zuo dedicieren/ oder zuo zeaygnenn. Genesis 4, 3–8 erzählt: Der Ackerbauer Kain opfert Gott Früchte, sein Bruder Abel, der Hirt, opfert Schafe, und Gott zieht dieses Opfer vor. Darauf erschlägt Kain Abel. – Steiner bringt das Bild, das zentral den Brudermord darstellt, wobei die Opfergaben im Hintergrund zu sehen sind. Der Text zur Entstehung des Opfers zitiert im ersten Satz diese Szene.
————————————— Ein weiteres Beispiel zu H.Steiners Vorgehen: Illustration eines fiktionalen Texts umgedeutet in die Illustration einer Anekdote Kapitel 96 von »Die geuerlicheiten vnd einsteils der geschichten des loblichen streytparen vnd hochberümbten helds vnd Ritters herr Tewrdannckhs«, Nürnberg, 1517 beschreibt folgendes (gekürzt): Neidelhart, Unfalo und Fürwittig – die drei Personifikationen, welche die Fahrt des Ritters Teuerdank (Tewrdannck) zu seiner Braut, der Königin Ehrenreich, verhindern möchten – wollen ihn mit Essen vergiften. Ein Türhüter hat sie bei den Beratungen belauscht und teilt das Ehrenhold mit, der Teuerdank stets positiv unterstützt. Er kann Teuerdank, der schon beim Essen sitzt – zurückhalten. Neidelhart lügt den Teuerdank an. Der Holzschnitt von Leonhard Beck zeigt die Szene: Am Tisch in Ritterrüstung sitzt Teuerdank; rechts mit flachem, konischem Helm und Plissé-Jupe Neidelhart; im Vordergrund in Rückenansicht Unfalo (er trägt das Fortuna-Rad auf dem Gewand); die hinzuschreitende Figur mit dem Pokal wird der Weinreinbringer sein (nach Robert Gernhardt, »Deutung eines allegorischen Gemäldes«) (Digitalisat eines kolorierten Exemplars > http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00013106/image_459; hier das Bild aus der Ausgabe Augsburg: Schönsperger 1519) Das Bild erscheint wieder in: [Johann Freiherr von Schwarzenberg], Das Büchle Memorial, das ist ein angedänckung der Tugend, von herren Johannsen vonn Schwartzenberg jetzt säliger gedächtnuss, etwo mit Figuren und reimen gemacht, Augspurg: Heinrich Steiner 1534, Fol. XCIIII verso :
Das Fortunarad auf dem Mantel von Ehrenhold ist weggeschnitten, und der Text lautet:
(Die witzige Anekdote könnte sich beziehen auf den damaligen Herzog von Mailand, den französischen König François Ier, nach der Schlacht von Landriano 1529.) Und so weiter Dies ist nur ein Aperçu. Und zur Ehrenrettung von Heinrich Steiner muss gesagt werden, dass eines seiner letzten Bücher (abgesehen vom Titelbild!) durchgehend mit einheitlichen nie-dagewesenen Holzschnitten (von Jörg Breu d.Ä.) ausgestattet ist: Ein Schöne Cronica oder Hystori bůch / von den fürnämlichsten Weybern so von Adams Zeyten an geweszt […] Erstlich Durch Joannem Boccatium in Latein beschriben / Nachmaln durch Doctorem Henricum Steinhöwel in das Teütsch gebracht […] Mit schönen Figuren durch auß geziert / Gantz nutzlich / lustig vnd kurtzweylig zů lesen. Gedruckt zu Augspurg / durch Hainrich Stayner / anno M.D.XXXXI. > http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00021201/image_2 |
||
Von Cicero über ein Emblembuch auf die OfenkachelDer sog. Petrarcameister war bei der Illustration der Übersetzung von Ciceros »De officiis« durch Johann von Schwarzenberg gefordert, abstrakte Aussagen zu visualisieren, hier die Stelle zu Beginn des zweiten Buchs, wo es heisst, dass das Nützliche (utile) und das Ehrenhafte (honestum) nicht getrennt werden könne
Der Meister greift zur Technik der Allegorie. Die moralischen Güter werden durch Kisten angedeutet, die durch die Beschriftung unterschieden werden: Erbarkeit (durch Gerechtigkeyt ergänzt), und Nutz. Die Unmöglichkeit der Trennung (Daz solchs kan mensch gescheiden kan) wird visualisiert durch Ketten zwischen den Kisten; die Dummheit (witz beraubt) der dies nicht Einsehenden (wer nicht diser warheit glawb) durch das törichte Hantieren an Kisten und Ketten sowie das Tragen von Augenbinde und Narrenkappe.
Das Bild wird – in eine Radierung umgearbeitet – von Christof Murer (1558–1614) in sein ›Emblembuch‹ entkontextualisiert übernommen (Nummer XXIX). Die Narrenkappen und Augenbinden fehlen; die gestikulierenden Zuschauer mögen entweder besagen: ›auseinander!‹ oder zeigen, dass das Unterfangen witzlos ist. Der Text ist etwas adaptiert:
Der Winterthurer David I Pfau verwendet das Motiv bereits 1636 für eine Ofenkachel in einem von Hans Heinrich I Pfau gefertigten Kachelofen in Winterthur (heute zerlegt im Landesmuseum Zürich):
Literaturhinweis: Margrit Früh, Winterthurer Kachelöfen für Rathäuser, Keramik-Freunde der Schweiz, Mitteilungsblatt 95 (1981) > Digitalisat > kkf-002_1981_0__18_d.pdf |
||
Von der Kosmographie ins »Wunderwerck«Auf der »Carta marina« von Olaus Magnus (Venedig 1539) sind über das Meer auf einer geographischen Karte monströse Fische verteilt: > https://de.wikipedia.org/wiki/Carta_Marina (dort sind weitere Digitalisate genannt). (In der »Historia de gentibus Septentrionalibus« (Rom 1555) werden diese Wesen dann freigestellt und einzeln abgebildet, vgl. Liber XXI. De piscibus monstrosis > http://runeberg.org/olmagnus ) Es gibt auch weitere Vorkommnisse monströser Fische, etwa das Thierbuch Alberti Magni. Von Art Natur vnd Eygenschafft der Thierer/ als nemlich von vier füssigen/ Vögeln/ Fyschen/ Schlangen oder kriechenden Thieren/ vnd von den kleinen gewürmen die man Insecta nennet/ durch Waltherum Ryff verteutscht. Frankfurt am Main: Jacob 1545:
Hans Rudolf Manuel Deutsch (1525–1571) hat sich hier (und womöglich anderswo – Conrad Gessners Fischbuch erscheint aber erst 1558) inspirieren lassen und die Fische geographisch entkontextualisiert und gleichsam in einem Wimmelbild zusammengestellt. Der doppelseitige Holzschnitt erscheint 1550 in einer Ausgabe von Sebastian Münsters »Cosmographia« (noch nicht in den Ausgaben 1545, 1546, 1548):
Der Holzschnitt wird übernommen in das im selben Verlag erscheinende Buch von Conrad Lycosthenes (1518–1561): Prodigiorum ac ostentorum chronicon, Quae praeter naturae ordinem, motum, et operationem, et in superioribus et his inferioribus mundi regionibus, ab exordio mundi usque ad haec nostra tempora, acciderunt ..., conscriptum per Conradum Lycosthenem; Basileae, per Henricum Petri [1557]. In der deutschen Fassung: »Wunderwerck oder Gottes unergründtliches vorbilden …« > http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00087675/image_42 (Seite xvvi/xvvii) Die Meerwunder sind im Bild mit Buchstaben von A bis V gekennzeichnet, und Sebastian Münster bringt eine Legende: Explicatio monstrorum quae in sequenti tabula suis picturis in aquis & terris designata / Erklerung disser tafel/ wie die seltzamme thier heissen so man in den mitnächtigen lenderen findt. (leider ohne Quellenangaben). Das Anliegen ist also ein kosmo-graphisches. Diese Legende klingt indessen aus in einem physikotheologischen Satz:
Das Wunderbare ist der Anlass dafür, dass Conrad Lycosthenes die Darstellung übernommen hat, wozu der Druckstock ja beim Verleger Heinrich Petri bereitlag. Lycosthenes hat sein Werk chronologisch aufgebaut, es beginnt mit der Schöpfung im Jahr 3959 vor Christi Geburt mit dem Titel
Als Wunder werden genannt: Noahs Regenbogen, Waldleute, auf Bäumen wachsende Leute, Kranichschnabelmenschen, auf Pferdehufen gehende Menschen, Blemmyer, Faune, Kynokephalen, Elefanten und andere exotische Tiere, Basilisk u.a.m. – dann eben auch (und hier profitiert er von der Legende S.Münsters) : Mörwunder/ die mit zänen/ hörnern/ im gsicht gantz grausam/ gleich fewr speyend/ vnd mit den augen zwitzern/ die sie so groß haben/ das ettwan ein aug sechzehen oder zwentzig schuoh weyt. Vierecket köpff haben sye/ vnd ein bart von stechlen wie die ygel … |
||
Vom Flugblatt ins naturwissenschaftliche WerkAnhand solcher Bildwanderungen von einer Gattung (die Medienwissenschaft spricht von ›Format‹) in eine andere wird ersichtlich, wie wenig konturiert die naturwissenschaftliche Welt im 16. Jahrhundert war. Literaturhinweis: Paul Michel, Das aller schützlichest thier so geseyn mag. Monströses in der frühneuzeitlichen Zoologie, in: Monster. Fantastische Bilderwelten zwischen Grauen und Komik, Bearb. von Peggy Große, G. Ulrich Großmann, Johannes Pommeranz. Begleitband zur Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum vom 7. Mai bis 6. September 2015, Nürnberg 2015, S. 47–59. Erstes Beispiel: Das ›Monstrum marinum‹ 1523 (frühestens) erscheint ein Flugblatt mit dem Titel Das merwunder ist gesehen worden zuo Rom in rippa/maiori an dem dritten tag des Nouemberß vnd ist gesein in der grösse als ein kindt von fünff iaren/ und ist diß die gestalt. Im Text steht dann, dass am 23. September in Neapel ein Komet am Himmel gestanden sei, und sich aus heiterem Himmel ein Wolkenbruch ergossen habe, es habe sich ein Erdbeben ereignet und dies alles habe große Schäden angerichtet. – Ein Bezug zum merwunder wird im Text nicht hergestellt.
Conrad Lycosthenes (1518–1561) publiziert 1557 auf lateinisch und deutsch ein mit gegen zweitausend (oft wiederholten) Holzschnitten ausgestattetes Buch, bestehend aus einer chronologisch geordneten Aufzählung von ›Wunderwerken Gottes‹, ›Prodigien‹, Erscheinungen, die ungewöhnlich sind (praeter naturae ordinem, motum, et operationem), von den üblichen Ordnungsregeln der Natur abweichen. Diese Monstra werden verstanden als Fingerzeig Gottes, der mahnt und droht; freilich werden die Ermahnungen selten ausgetextet. Hier heißt es zum Jahr 1523, im September sei in Neapel ein Strobelstern (Komet) erschienen. Dann (in der deutschen Übersetzung des lateinischen Lycosthenes von Johann Herold):
Conrad Gessner (1516–1565) bringt im Fischbuch (1558) das Bild eines Meerwunders, das am 3. November 1523 in Rom gefunden worden sei. Auch er nennt den Wolkenbruch in Neapel im September 1523, aber der lateinische Text verwendet andere Worte. In der deutschen Übersetzung von Forrer 1563 lautet das so:
Das zugehörige Bild ist in der lat. Ausgabe 1558 angeschrieben mit Monstrum marinum, ex tabula quadam impressa in Germania olim. Bei diesem ›einst in Deutschland gedruckten Bild‹ handelt es sich um das erwähnte Flugblatt mit deutschen Text und dem Bild des aus Fischleib und Frauenoberkörper zusammengesetzten Monstrums:
Beide Autoren haben dasselbe Flugblatt verwendet (und dessen deutschen Text verschieden ins Lateinische übersetzt). Dass Lycosthenes sein Buch aus Flugblättern mit Wunderberichten speist, ist nicht erstaunlich; dass der Naturforscher Gessner solche Quellen beizieht, aber schon. Das Meerwunder wird dann weitertradiert: Selbstverständlich kennt es Ulisse Aldrovandi (1522–1605) in seinem 1642 postum erschienenen Werk »Monstrorum historia«:
Sodann Kaspar Schott, S.J. (1608–1666), der es 1662 zusammen mit anderen Monstra abbildet:
Zweites Beispiel: Das Meer-Schwein (›Porcus Marinus‹) |
||
Von der Mythologie / Bibel ins naturwissenschaftliche WerkHier Beispiele aus der deutschen Übersetzung der Plinius-Teilausgabe (1565), die vom Übersetzer Johannes Heyden, Eifflender von Dhaun mit vielen fürtrefflichen Historien gebessert und gemehrt wurde: Caij Plinij Secundi / Des furtrefflichen Hochgelehrten Alten Philosophi / Bücher und schrifften / von der Natur / art vnd eigentschafft der Creaturen oder Geschöpffe Gottes […] Auß dem Latein verteutscht durch M. Johannem Heyden / Eifflender von Dhaun […] Mit einem Zusatz auß H. Göttlichen Schrifft, vnd den alten Lehrern der Christlichen Kirchen, Frankfurt: Sigmund Feyerabend 1565. Leider schlecht digitalisiert bei > http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10140858.html Erstes Beispiel: Im Kapitel über den Wolf (vgl. Plinius, nat. hist. VIII, xxxiv, 80–84 [moderne Zählung]) erwähnt die Erweiterung des Übersetzers die Geschichte von Romulus und Remus aus der Stadtgeschichte von Livius. S.Feyerabend setzt das Bild von der Romulus und Remus säugenden Wölfin dazu: Das Bild erscheint (passend) in einer Ausgabe von Livius in seinem Verlag: Titus Liuius, Vnd Lucius Florus. Von Ankunfft vnd Vrsprung deß Römischen Reichs/ der alten Römer herkommen/ Sitten/ Weyßheit ... Auch von allerley Händeln vnd Geschichten/ so sich in Fried vnd Krieg, zu Rom/ in Italia/ vnd bey andern Nationen ... fast innerhalb acht hundert jaren ... biß auff der ersten Römischen Keyser Regierung/ verloffen vnd zugetragen Jetzund auffs neuw auß dem Latein verteutscht … durch Zachariam Müntzer; Mit schönen Figuren geziert/ deßgleichen vorhin im Druck nie außgangen. Franckfurt am Mayn: Raab, Feyrabend und Han 1568. Dasselbe Bild hat er wieder verwendet in: Neuwe Livische Figuren/ Darinnen die gantze Römische Historien künstlich begriffen und angezeigt. Geordnet und gestellt durch ... Johann Bockspergern von Saltzburg, den jüngern und mit sonderm fleiß nachgerissen durch ... Joß Ammann von Zürych. Nachmals mit Teutschen Reimen kurtz begriffen und erkl. durch Heinrich Peter Rebenstock ... Franckfurt am Mayn: Raben und Hauen, 1573. Bibliothekskataloge weisen keine bei Feyerabend gedruckte Livius-Ausgabe vor 1568 nach. Möglicherweise lag das Bild mit der die Kinder säugenden Wölfin für die Livius-Ausgabe schon bereit und wurde von Feyerabend bereits vorher in das naturkundliche Werk von Plinius inseriert. Zweites Beispiel: Die Übersetzung von Plinius (naturalis historia VII, 204) lautet: Die Music bracht auff der Amphion; Die Pfeiffen vnd auff einer pfeiffen zuo spielen des Mercurij Son; Daz krumme Horn Midas in Phrigia; Die Sackpfeiffen Marsyas im selbigen Lande. Randglosse von Johannes Heyden: Moses vnd Josephus bezeugen der Jüdische Tubal/ des Lamechs Son/ habe der Music fleissig gewartet/ vnnd auff dem Psalter vnnd zuo der Harpffen gesungen. (Der Schmied Tubal, vgl. Genesis 4,22, repräsentiert bei der Darstellung der Sieben Freien Künste die Musik, die er beim verschieden tönenden Schlagen auf den Amboss erfunden hat.) Das Bild dazu bezieht der Verleger aus der bei ihm erschienenen Bilderbibel. Es ist die Szene der Begegnung von Jephta mit seiner Tochter: Der Heerführer von Gilead, Jephta, gelobt Gott, nach einem Sieg gegen die Ammoniter das zu opfern, was ihm bei seiner Rückkehr als erstes aus seinem Haus entgegenkommt. (Richter 11,31). Nach dem Sieg kommt seine Tochter ihm tanzend entgegen:
In der Bibel steht freilich nichts von einer Harfe, sondern die Tochter erscheint cum tympanis et choris: mit Paucken und Reigen (Luther-Übersetzung 1545)! — In der Plinius-Übersetzung aber steht S.80 gleich über dem Bild: Die Harpff erdacht Amhion/ oder Orpheus/ oder als andere melden: Linus […]. Drittes Beispiel: Im Kapitel über den Drachen (Plinius, nat.hist. VIII, xiii – xiv) bringt Feyerabend auf S. 103ff. zunächst einen Holzschnitt, den er – wie viele andere – aus dem Thierbuch Alberti Magni (Frankfurt am Main: Jacob 1545) übernimmt, das ist immerhin ein zoologisches Werk:
Dann folgen Holzschnitte, die Virgil Solis (1514–1562) für die Ausgabe von Ovids Metamorphosen erschaffen hat, die eben gerade bei Feyerabend erschienen ist: Metamorphoses Ovidii, Argumentis quidem soluta oratione, […], summaque diligentia ac studio illustratae, […] una cum uiuis singularum transformationum Iconibus a Virgilio Solis, eximio pictore, delineatis, Frankfurt: G. Coruinus, S. Feyerabent, & haeredes VVygandi Galli, 1563.
Hier das Bild aus dem Ovid zur Szene, wo Apollo den Drachen Python tötet, im ursprünglichen Kontext:
Viertes Beispiel: Das Kapitel über die Heuschrecken (Plinius nat. hist. XI, xxxv, 101ff. de locustis) vermehrt der Übersetzer Johannes Heyden mit Zitaten aus der Bibel (Jesaias 40; Proverbia 30; Exodus 10; Matthäus 3; Amos 7). Während sich Feyerabend für die Seidenraupe (Bombyx) und die Indianische Ameise im Thierbuch Alberti Magni. Von Art Natur vnd Eygenschafft der Thierer/ als nemlich von vier füssigen/ Vögeln/ Fyschen/ Schlangen oder kriechenden Thieren/ vnd von den kleinen gewürmen die man Insecta nennet/ durch Waltherum Ryff verteutscht, Frankfurt am Main: Jacob 1545 bedienen konnte, fehlt ihm in der (noch raren) zoologischen Literatur ein Bild der Heuschrecke. Das Insektenbuch hatte Conrad Gessner (gest. 1565) nicht mehr herausgeben können; es ist eingegangen in das Buch von Thomas Muffet (1553–1604): Insectorum sive minimorum animalium theatrum: olim ab Edoardo Wottono, Conrado Gesnero, Thomaque Pennio inchoatum: tandem Tho. Movfeti Londinâtis operâ sumptibusq; maximis concinnatum, auctum, perfectum: et ad vivum expressis iconibus suprà quingentis illustratum. Londini: ex officinâ typographicâ T. Cotes 1634. Hier gäbe es ein Bild. Das Buch kennt Feyerabend offenbar nicht. – Aber er ist nicht verlegen (S. 491): Das Bild stammt aus der Aesop-Ausgabe, die Virgil Solis (1514–1562) illustriert hat. Aesopi Phrygis fabulae […], Francofurti ad Moenum: Corvinus, Feyrabend & Gallus 1566. Es gehört zur Fabel der im Sommer musizierenden Grille und der fleißigen Ameise (Perry Nr. 373).
Ein noch ungeklärter Fall. Dieses Bild ist aus biblischen Elementen komponiert: Der von der Fußsohle bis zum Scheitel mit Geschwüren bedeckte (Hiob 2, 7) Hiob, der in der Pose des Melancholikers auf dem Misthaufen sitzt; seine törichte Frau, die ihm vorwirft, an seiner Frömmigkeit festzuhalten (Hiob 2,9: Vg.: Benedic Deo et morere!); darüber der Teufel (Satan, der die Frömmigkeit Hiobs testen will; Hiob 1,6ff. und 2,1ff.).
Das Bild wurde ebenfalls übernommen, aber als Illustration eines an der Lepra Leidenden in Johannes von Gersdorff, Feldtbuch der wundtartzney, Straßburg: Schott 1517:
|
||
Von der Bibelillustration ins ethnographische WerkOlaus Magnus (1490–1557, aus Götland) verfasst 1555 sein gewaltiges Werk über die Länder des Nordens. Darin beschreibt er auch die Kornernte. Liber XIII, Cap. viiii: De diversitate messium colligendarum. (Deutsche Übersetzung, Basel 1567; XIII,5:) Von der Ernd oder Schnitt- vnd wie man die Frucht in die Scheüwrn samlet. Olaus berichtet, wie die Menschen in den mitnächtigen Ländern im Augst mit gemeiner hülff und guotem muot der Bauwrn eingeschnitten werden; als Lohn heischen die Helfer nur eine fröliche abendzech … Zu jedem Kapitel bringt er auch einen Holzschnitt, hier:
Das Bild beruht nicht auf Beobachtung norröner Bauern, sondern stammt weitgehend aus einer Bibelillustration; die skandinavische Ährenleserin hat einen Migrationshintergrund: Hans Holbein der Jüngere (1497–1543) ist nach Ausweis eines Lobgedichts in der Ausgabe 1539 der Schöpfer der 91 Bilder der Lyoner Bilderbibel: Historiarum veteris Testamenti Icones ad vivum expressae, Lugdunum 1538. – 2. Auflage mit französischen Übersetzungen: Lugduni, sub Scuto Coloniensi [François et Jean Frellon]. M.D.XXXIX, 1539. > http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00075239/image_1 Im Buch Ruth wird geschildert, wie Ruth auf dem Feld des Boas hinter den Schnittern die übrig gebliebenen Ähren aufliest. Boas fragt die Schnitter, wer die junge Frau sei. Usw. Typisch für eine Kopie eines Holzschnitts ist, dass er seitenverkehrt ist. Dem Boas hat der Illustrator von Olaus Magnus einen Weinkrug in die Hand gegeben; wohl ein Hinweis auf die fröliche abendzech. (Übrigens: Man liest immer wieder, die Illustrationen der Zürcher Bibel von 1531 stammten von Holbein. Das ist falsch. Ein unbekannter, nicht unbegabter Künstler hat die von Holbein geschaffenen, aber erst 1538 publizierten Holzschnitte kopiert. Das Bild von Ruth beim Ährensammeln kommt 1531 nicht vor.) Auf diese Übernahme hat hingewiesen Nils-Arvid Bringéus, Volkstümliche Bilderkunde, München: Callwey 1982, S. 89. |
||
Johann Jacob Scheuchzer (1672–1733)J. J. Scheuchzer sammelte zeit seines Lebens Materialien für eine Enzyklopädie. Bei der Anordnung folgte er indessen nicht einer wissenschaftlich-synthetischen Systematik, sondern er folgt dem Textablauf der Offenbarung in der Bibel, von der Genesis bis zur Apokalypse, weil er der Ansicht ist, dass der inspirierte Bibeltext die sinnreichere Abfolge der Gegenstände abgibt als ein vom Menschen ausgehecktes System. So entstanden die vier Foliobände der »Physica Sacra«. Zu allem Möglichen, was in der Bibel vorkommt, bringt er seine Lesefrüchte und Erkenntnisse aus den eigenen Sammlungen an: Astronomie – Meteorologie – Metallurgie – Botanik – Zoologie – Anthropologie – Numismatik – Antikenkunde – Geographie; alles steht im Sinne der Physikotheologie im Dienst der Erkenntnis von des Schöpfers Allmacht, Weisheit, Güte.
Das Werk enthält 750 informationstragende Illustrationen (Kupferstiche in Folioformat, plus einige weitere Bilder). Scheuchzer überwachte das Bildprogramm genau. In den erhaltenen Manuskripten (Druckvorlagen) sieht man Zeichnungen von seiner Hand sowie auch aus Büchern ausgeschnittene und eingeklebte Bilder (cut and paste). Scheuchzer bekennt sich zum Eklektizismus. In der Vorrede zur Physica Sacra schreibt er 1731: Steine und Holtz nehme ich von andern, die Aufrichtung und Gestalt des Gebäudes aber ist gantz unser; Ich bin der Baumeister, ob ich wol die Baugeräthe da und dorten her zusammen getragen; das Gewebe der Spinnen ist deßhalben nicht umso besser, weilen sie die Faden aus sich selbsten spinnet: Und unsere Arbeit um deßwillen nicht desto geringer, weilen wir dieselbige gleich denen Bienen aus andern saugen (auch dieser Vergleich ist ein Zitat; aus Justus Lipsius). Scheuchzer zitiert seine Quellen in der Regel hinlänglich genau, so dass sie mit den modernern bibliothekarischen Techniken gefunden werden können. (Es wäre ein umfangreiches Projekt, die Quellen der ca. 2000 Bilder ausfindig zu machen.) Literaturhinweise speziell zur Illustrationstechnik Scheuchzers: Robert Felfe, Naturgeschichte als kunstvolle Synthese. Physikotheologie und Bildpraxis bei Johann Jakob Scheuchzer, Berlin: Akademie-Verlag, 2003. Jochen Hesse, »Zur Erläuterung und Zierde des Wercks«. Die Illustrationen der Kupferbibel »Physica Sacra«, in: Urs B. Leu (Hg.) Natura Sacra. Der Frühaufklärer Johann Jakob Scheuchzer (1672–1733), Zug: Achius-Verlag 2012, S. 105–128. Irmgard Müsch, Geheiligte Naturwissenschaft. Die Kupfer-Bibel des Johann Jakob Scheuchzer, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000 (Rekonstruktion der Künste, Band 4). Erstes Beispiel: Der Vogel Strauß Im 3. Buch Moses (Leviticus), Kapitel 11 ist von den reinen und unreinen Tieren die Rede. Vers 16 wird der Verzehr von Straußenfleisch verboten. Das gibt Scheuchzer Gelegenheit, über diesen Vogel zu schreiben (S. 415): Der Strauß nistet auf der Erde und verschlingt alles, was ihm vorkommt; sein Fleisch und seine Eier sind hart zu verdauen und von schlechter Nahrungs-Krafft, was auf den Magen des Straußes zurückzuführen ist. Nach Ansicht der älteren Zoologie (die Scheuchzer nicht referiert), frisst der Strauß Eisen. Hierzu zitiert Scheuchzer ausführlich Vallisnieris Sektionsbefund eines Straußenmagens (s. unten): In einem ersten Sack befanden sich allerhand ohne Unterscheid eingeschluckte Sachen, Kräuter, Saamen, Früchte, Stein, Nägel, Strick, Glaß, Müntzen, Bley, Zinn, Kupfer, Beine, Holtz. […] Der Magen-Hebel oder Dauungs-Safft und Säure sey sehr scharff und etzend […]. Die dadurch ermöglichte Verdauung von Stein und Metallen mache das Fleisch ungenießbar, und werde deshalb von der hl. Schrift verboten. Viele Bilder bei Scheuchzer sind so organisiert: • ein Architekturrahmen – der hier das Ei des Straußes enthält – umschließt weitere Elemente: • Bildspiegel, hier eine (nicht bedeutungstragende) Landschaft, in dem der Magen des Straußes liegt; • über den Rahmen gehängt und den Bildspiegel teils verdeckend hängt ein Papier / eine Leinwand, auf der eine Zeichnung mit einer anderen Ansicht desselben Tiers (hier das Skelett) gezeigt wird.
Das Tier hält ein Hufeisen im Schnabel, was hier seine Gewohnheit andeuten soll, Eisen zu fressen. Gegen diese Meinung haben Albertus Magnus (de animalibus, Lib. XXIII, Cap. 24, ¶ 139) und Sir Thomas Browne (1605–1682) in seiner »Pseudodoxia Epidemica« (Book III, Chapter xxii) polemisiert. — Aber: Auskunft des Zootierarzts J.-M. Hatt (Zürich, Januar 2020): Dass der Vogel Strauss Eisen (und anderes, was sonst noch glänzt) frisst, ist vielfach beobachtet. Verdauen kann er Eisen nicht, und unzählige Tiere sind an Perforationen des Magens verendet. Bei verzinkten Nägeln kam wohl noch eine Vergiftung hinzu. Einen Beitrag zum Aberglauben, dass Eisen verdaut werden könne, leisten die Steine, welche im Muskelmagen von Straussen gefunden werden. Diese Steine unterstützen die Zerkleinerung des Futters und sie werden aktiv gesucht und aufgenommen. Gemäss der Futteranweisung für die Tiere werden ihnen im Zürcher Zoo in einer Schale runde Steine (Durchmesser 2–3 cm) angeboten! Literaturhinweis: Thierry Buquet, Can Ostriches Digest Iron? > http://mad.hypotheses.org/131 {Mai 2015} In der Kosmographie des Sebastian Münster (1488–1552; es gibt viele Ausgaben, wir greifen die von 1546 heraus) wird die Geschichte mit Bild kolportiert: So man disen vogel abthuot/ findt man gemeinlich in seinem magen stein vnd etwan eysen/ vnd die soll er verzeren so sie lang bey im geligen.
Dasselbe Bild erscheint in der im selben Verlag erscheinenden deutschen Übersetzung des spätantiken Geschichtsschreibers Diodorus Siculus – allerdings ohne die Geschichte vom Eisen-Fressen, denn hier liegt eine andere Texttradition vor, hier möglicherweise ein authentische Beobachtung:
In der deutschen Übersetzung der Plinius-Teilausgabe ziert ein ein Hufeisen fressender Strauß das Titelbild des Kapitels über die Vögel
Im Text (S. 400) freilich wird Albertus Magnus zitiert: Albertus: Vom Strauß wirt gesagt/ er sol das Eisen fressen/ vnnd Stahel verdöuwen mögen/ aber solchs hab ich noch nit erfahren/ denn wie wol ich vil mal den Straussen Eisen fürgeworffen/ so haben sie es doch nit wöllen fressen/ oder insich schlucken/ aber grosse Bein zuo kleinen stücklin urschlagen/ vnd harte Kißling haben sie verschluckt. In Ulyssis Aldrovandi Ornithologiae, hoc est de avibus historiae libri XII, Tomus I, 1599 hält der Strauß auf S. 591 ein Hufeisen im Schnabel; S. 597 ist ein Skelett gezeichnet, aber ohne Hufeisen. Im Text wird der Bericht von Albertus Magnus zitiert.
In der barocken Emblematik ist die Vorstellung beliebt:
Das Bild des Skeletts stammt aus Gerhard Blasius (1625–1692), Tab. XXXIX, Nr. IV. Warum dieser Anatom es hat durchgehen lassen, dass auf seinem Bild der Strauß ein Hufeisen im Schnabel hält? Oder ist das ein Scherz? Und warum Scheuchzer es hat durchgehen lassen, dass dieses Bild so übernommen wurde? Oder ist das auch ein Scherz?
Antonio Vallisnieri (1661–1730) hat den Magen eines Straußes obduziert und genau beschrieben und mitsamt einem darin steckenden Nagel abgezeichnet. Scheuchzer übernimmt und zitiert das Bild.
Woher mag die Idee des Bildaufbaus mit dem ausgerollten Bild stammen? Ein frühes Beispiel ist Claude Perrault (1613–1688):
Gerhard Blasius kopiert 1681 diese Struktur (Tafel XIV): Eine Anregung mag auch das Buch von Michael Bernhard Valentini gewesen sein:
Zweites Beispiel: Die Herzpumpe Der Psalmvers 33,15 »Er hat ihrer aller Hertzen gestaltet« gibt Scheuchzer Gelegenheit, über das Herz als Objekt der Anatomie zu sprechen. (Der theologische Gehalt des Psalms – es geht hier um das Herz als innerstes Organ, in dem Gott den Menschen erkennt – wird im Bildspiegel nur gerade angetönt, wo ein Mann von einem aus dem Himmel hervorstrahlenden Satz getroffen wird: Gib mir, mein Sohn, dein Hertz – fili mi praebe cor tuum [Sprüche 23,26] und sich ans Herz greift.) Scheuchzer beschreibt (mit Verweis auf die Abbildung unten in der Rahmenzone des Kupferstichs) das Funktionieren einer Feuerspritze mit zwei Zylindern, Ansaug- und Ausgangsventilen. Der Vergleich des Herzens mit einer Pumpe geht zurück auf den Entdecker des Blutkreislaufs, William Harvey (1587–1657, De motu cordis et sanguinis, 1628):
Im Sinne der Iatromechanik wird das Organ hier als eine feinsinnigere Maschine aufgefasst.
Die anatomischen Bilder des Herzens könnte der Arzt Scheuchzer durchaus aus eigener Anschauung beigebracht haben. Hier interessiert das Bild der Feuerspritze. Es ist einer Abhandlung von Giovanni Alfonso Borelli (1608–1679) »De Motu Animalium« entnommen. In der deutschen Bearbeitung von S. H. Schmidt heißt es nach einer ausführlichen Beschreibung der Anatomie: Es
Das Modell erscheint ebenfalls in der berühmten Graphik von Dr. Fritz Kahn (1888–1968) »Der Mensch als Jndustriepalast« (1926):
|
||
ZitatErstes Beispiel: Naturwissenschaftliches Werk Conrad Gessner (1516–1565) hat seine Tierbücher immer wieder aufgrund der neuesten Lesefrüchte und Zusendungen von Briefpartnern ergänzt. Gelegentlich zitiert er seine Quellen recht präzis im Text. Hier zum Drachen:
Mit Bellonius ist gemeint der französische Naturforscher Pierre Belon (1517–1564), der seine Reisen dokumentierte:
In der gekürzten Ausgabe des Tierbuchs stellt er ein Tier namens Su vor, das dem eben gerade erschienenen Bericht des Brasilienreisenden André Thevet (1516–1590) entlaufen ist.
In der lateinischen Erstausgabe »de Quadrupedibus uiuiparis« 1551 und in den »Icones« 1553 kannte Gessner das Tier noch nicht. Gessner besaß die Pariser Ausgabe des Werks von Thevet und die von Antwerpen; beide hat er eifrig annotiert; vgl. Urs Leu (1992). In der deutschen Übersetzung von 1563, wo es dann auch das Titelblatt ziert, ist es Das aller schützlichest thier so geseyn mag/ Su genant in den neüwen landen.
Zweites Beispiel: Buntschriftsteller Die Buntschriftstellerei lebt definitionsgemäß von Zitaten; erstaunlich oft werden diese quellenmäßig nachgewiesen. Als Beispiel Zitate bei Eberhard Werner Happel (1647–1690) – mehr zu ihm hier: Die Bilderwelt in Eberhard Werner Happel, »Gröste Denckwürdigkeiten der Welt« [Link auf eine Website der UZH]
• In einem der ersten Hefte seiner Wochenschrift referiert Happel das Buch »Mundus Subterraneus« des Universalgelehrten Athanasius Kircher (1602–1680), der aufgrund bestimmter Beobachtungen annahm, die Meere seien durch unterirdische Ausgänge miteinander verbunden und unter der Erde gebe es reichhaltige Reservoirs sowie ein das Wasser heizendes Zentralfeuer.
Bei Happel (S. 170ff.) ist der ursprünglich zwei Folioseiten große Kupferstich auf einen Holzschnitt im Oktavformat verkleinert: Abbildung der Unter-irdischen Wassergänge und wie ein Theil des Wassers vom Centralischen Feüwer erhitzet werde.
Die unterirdischen Wasser spielen eine Rolle in Grimmelshausens »Simplicissimus« (1669; 5. Buch, Kapitel 10ff.), wo der Held in den Mummelsee eintaucht und von dort in das Centrum Terræ fährt und wieder zurückreist. • Mehrmals zitiert Happel aus dem jüngst erschienenen Buch des Reiseschriftstellers Eduard Melton
- Die chinesischen Gaukler
- Die Witwenverbrennung (sutee, sati) in Indien
Drittes Beispiel: Anspielung in der politischen Karikatur Das Buch Scènes De La Vie Privée Et Publique Des Animaux. Études De Mœurs Contemporaines, Publiées Sous La Direction De M. P.-J. Stahl, […] Vignettes Par Grandville, Paris: J. Hetzel 1842. wird eröffnet mit einem »Prologue. Assemblée Generale des Animaux«, der besagt, dass die Tiere, müde geworden, sich von den Menschen benutzen und zugleich verleumden zu lassen, zu einer beratenden Versammlung zusammengetreten seien, um über die Mittel nachzudenken, durch welche sie das Menschenjoch abschütteln könnten. Ein Journalist habe einen Bericht über dieses Parlament verfasst, das vielfache Ähnlichkeit mit ähnlichen Versammlungen der Menschen habe. Politischer Hintergrund: Unter König Loius-Philippe I wurde 1835 in Frankreich eine Presse-Zensur eingeführt (sog. Septembergesetze). Grandville (1803–1847) gibt 1842 dem Prolog ein Bild bei, das das Cabinet de Redaction zeigt: Ein Affe – der Chefredaktor oder der Zensor? – vor den ihm Texte zutragenden Journalisten, die als Vögel visualisiert sind. Das Bild spielt an auf eine Karikatur aus dem vorrevolutionären Frankreich. Charles Alexandre de Calonne ließ 1787 die Assemblée des notables einberufen, der er das Defizit in der Schatzkammer darlegte. Er schlug die Einführung einer Steuer vor, die auf jede Art von Eigentum ohne Unterschied erhoben werden solle.
Einfache Übernahme oder mittels Zitat intendierte Aussage? Aeneas fährt mit seinen Schiffen von Sizilien aus Richtung Italien. Die den Trojanern zürnende Göttin Juno lässt Aeolus einen Seesturm entfesseln, der die Flotte teilweise zerstört. Der Aeneas gewogene Gott Neptun glättet die Wogen. Aeneas und Gefährten steuern auf Libyen zu und gelangen nach Karthago. (Vergil, Aeneis I, 50ff. und 124ff.) Sebastian Brant (1457–1521) bringt in seiner reich bebilderten Vergil-Ausgabe (1502) folgenden Holzschnitt zur Szene. (Oben rechts Juno, die Aeolus überredet; links die in alle vier Himmelsrichtungen ausströmenden Stürme; Mitte links Neptun, der das Meer beruhigt.)
Der Forschung ist schon früh aufgefallen, dass die zwei prominent gezeigten Schiffe ziemlich genaue Übernahmen sind aus der Publikation, durch die 1494 die Reise des Kolumbus bekannt wurde – ein Buch, das der damals in Basel lebende Brant mitbetreut hat:
Bernd Schneider plädiert in seinem vorzüglichen Aufsatz dafür, »dass Brant mit der Übernahme der Schiffe auch Parallelen zwischen der Reise des Aeneas von Troja zu den neuen Ufern Italiens und der Entdeckerfahrt des Kolumbus in die neue Welt andeuten wollte.« Man könnte sich indessen auch fragen, woher der Illustrator um 1500 sonst Bilder von Hochseeschiffen hätte bekommen können? (Allenfalls in der Bibel die Arche Noahs oder das Schiff von Jonas; oder das Schiff des Ulisses in der Schedelschen Weltchronik Fol. XLIr). Im 10.Buch, wo Aeneas dann wirklich in Italien ankommt, kommen viele Schiffe vor (Verse 166ff., 219ff., 287ff.), die alle visualisiert werden, aber anders. Auch war Brant von ›kolumbischen‹ Erkundungsfahrten keineswegs begeistert. Im »Narrenschiff«, Kap. 66 Von erfarung aller land schreibt er 1494:
Literatur: Bernd Schneider, ›Virgilius pictus‹. Sebastian Brants illustrierte Vergilausgabe von 1502 und ihre Nachwirkung. Ein Beitrag zur Vergilrezeption im deutschen Humanismus, in: Wolfenbütteler Beiträge Bd. 6 (1983) S. 202–262, bes. S. 219; mit Verweis auf Anna Cox Brinton, The Ships of Columbus in Brant’s Virgil, in: Art and Archaeology 26 (1928), p. 83–86. 94. |
||
Bild-Übernahmen in Kinder-EnzyklopädienErstes Beispiel Die Illustratoren Daniel Nikolaus Chodowiecki (1726–1801) / Johann Ulrich Schellenberg (1709–1795) übernehmen von allüberall her Bildvorlagen zur Illustration des Werks von Johann Siegmund Stoy (1745–1808):
Mehr zu Kinderenzyklopaedien hier; sowie: Christiane Reuter, Johann Sigmund Stoys »Bilder-Akademie für die Jugend« – ein Bilder-Lehrbuch der Aufklärung. [leider] Unveröff. Magister-Arbeit der Universität Erlangen-Nürnberg 1994. [Mit Auflistung der Bildvorlagen und Besprechung der Umformungen] Anke te Heesen, Der Weltkasten. Die Geschichte einer Bildenzyklopädie aus dem 18. Jahrhundert, Göttingen: Wallstein-Verlag 1997. Zweites Beispiel Friedrich Justin Bertuch hat für seine Enzyklopädie für Kinde rständig auf Bildmaterialien zurückgegriffen; hier ein Beispiel:
Viele Hinweise dazu in: Silvy Chakkalakal, Die Welt in Bildern. Erfahrung und Evidenz in Friedrich J. Bertuchs »Bilderbuch für Kinder« (1790-1830), Göttingen: Wallstein 2014. |
||
Bild im BildFür literarische Werke gilt, dass sie nicht nur die Wörter aus einer gemeinsamen Sprache beziehen, sondern auch Gedankensplitter, Formeln, ›Topoi‹, ganze Textpassagen. In der Literaturwissenschaft läuft diese Forschung unter dem Stichwort ›Intertextualität‹. Bedeutende Erforscher sind etwa Ernst Robert Curtius (1886–1956) und Gérard Genette (1930–2018). Die Übergänge zum Zitat sind fließend. Nutzliche Zeitbetrachtung / fürgebildet Durch Conrad Meÿern [1618–1689] Maalern in Zürich, [erschlossen 1675]; Zehen Jahr:
• An die lernbegierige Zürcherische Jugend auf den Neujahrstag 1805 Von der Gesellschaft auf der Chorherren. 27.Stück — Thema ist, wie die Kinder um 1750 in der Schule und daheim gehalten wurden. Das von Johann Martin Usteri (1763–1827) gezeichnete Titel-Kupfer: Eine Mutter zeigt ihren Kindern ein Neujahrsblatt. Die Kinder schauen das Bild an, die Mutter liest ihnen dazu dann den Text vor. Das Bild-Arrangement ist übernommen; aber noch mehr: In dem Möbel (oberhalb der Köpfe der beiden Kinder) erkennt man ein Bild. Es handelt sich – wie auf dem Kupfer von ca. 1675 – offensichtlich um ein Neujahrsblatt von Conrad Meyer:
Das Bild vom jungen Holz, das noch ›biegsam‹ ist, hat seinerseits ein Vorbild in der Emblematik des 16. Jahrhunderts:
Und die Idee wurde auch von anderen Autoren verwendet; sinnvollerweise für ein Titelblatt eines Buches zur Erziehung:
Literaturhinweis zum NJbl 1650: Martina Sulmoni, »Einer Kunst- und Tugendliebenden Jugend verehrt«. Die Bild-Text-Kombinationen in den Neujahrsblättern der Burgerbibliothek Zürich von 1645 bis 1672, Bern: Lang, 2007 (Deutsche Literatur von den Anfängen bis 1700; Band 46), S. 156–164. Zweites Beispiel Die Szene im Vordergrund unten stellt die Episode dar, die geschildert wird in Matthäus 26,6ff:
Die Szene ist seltsamerweise (aber in diesem Bibelbuch nicht unüblich) situiert vor einer üppigen Palastwand. Und darauf sind Bilder angebracht, welche die Fortsetzung der Geschichte zeigen:
Drittes Beispiel Eine einfache Übernahme aus der einschlägigen gelehrten Literatur findet sich auf diesem Bild, das den Kontinent America (vgl. mehr zu diesem Bildtyp hier) versinnfälligt:
Das Bild hatte schon der Buntschriftsteller Erasmus Francisci 1668 übernommen:
Und noch 1884 erinnert Franz Reuleaux daran, dass die Indianer Nordamerikas ihr Wild durch Nachahmung tierischer Gestalten beschleichen:
|
||
Vom unsorgfältigen Umgang mit den DruckstöckenDie Illustratoren der Vergilausgabe 1502 zeigen auf mehreren Bildern die Unterwelt, die Vergil im 6.Buch der »Aeneis« schildert. So sind zu Vers VI,295ff. die Unterweltsflüsse Acheron, Cocytus und Styx zu sehen, der Fährmann Charon, der Seelen in seinem Nachen übersetzt; im Hintergrund rechts Aeneas in der Begleitung der Sibylle, der dem Palinurus begegnet. Über der Quelle der Unterweltsflüsse das Maul eines riesigen Ungetüms. Die Darstellung mag angeregt sein durch den im Text erwähnten Schlund des Orcus (in faucibus Orci Vers 273), beruht aber wohl auf der gängigen Ikonographie des Höllenschlunds, in den die sündigen Seelen durch Teufel hineingetrieben werden oder aus dem die Abgeschiedenen ein Engel oder Christus hinausführt; vgl. > https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Harrowing_of_Hell.jpg > https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Hellmouth.jpg
Das Höllenmaul ist wohl der Anlass dafür, dass der Verleger Grüninger das Bild in Gregor Reischs »Margarita Philosophica« übernommen hat, um das Kapitel De locis infernalibus (Liber undecimus, Cap. xlij) zu illustrieren: Vier verschiedene Orte der Hölle im Gebiet des Leides. Ort und Art der Vorhölle der Väter. …. Grüninger übernimmt das (in seinem Verlag zwei Jahre zuvor erschienene) Bild der heidnisch-antiken Unterwelt tel quel als Bild für die christliche Hölle; und weil es nicht in das kleinere Buchformat (von Quart zu Oktav) passt, sägt er es kurzerhand oben und links ab!
In der Erstausgabe Freiburg: Schott 1503 > dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/reisch1503 Blatt 254b wurde dieses Bild kopiert und neu geschnitten; dabei ist die Personen-Gruppe um Aeneas durch einen Seelen peinigenden Teufel ersetzt, die Flussnamen sind weggelassen, aber seltsamerweise Charon noch mit einer Banderole angeschrieben. (Dieses Bild erscheint dann auch im Druck Basel: Furter 1517). Literatur: Reisch, englische Übersetzung: Sachiko Kusukawa / Andrew R. Cunningham, Natural philosophy epitomised: Books 8-11 of Gregor Reisch’s Philosophical Pearl (1503). Aldershot: Ashgate 2010; S. 300f.. Reisch, deutsche Übersetzung von Otto und Eva Schönberger, Würzburg: Königshausen & Neumann 2016; S. 476f.. Johannes Pommeranz, Die Hölle und ihr Rachen, in: Monster. Fantastische Bilderwelten zwischen Grauen und Komik, Bearb. von Peggy Große, G. Ulrich Großmann, Johannes Pommeranz. Begleitband zur Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum vom 7. Mai bis 6. September 2015, Nürnberg 2015, S.379–405. |
||
Wiederverwendung im Reprint – – – RaubdruckWann kann man von einem vertretbaren Reprint reden, wann handelt es sich um einen Raubdruck? — Die Abgrenzung von anderen Formen (Zitat, Kontrafaktur, Montage, Parodie usw.) und die Geschichte der Copyright-Gesetzgebung ist komplex. ♦ Das Kopieren eines Texts oder Bilds war im Mittelalter / in der Frühneuzeit nichts Ehrenrühriges; der Begriff des ›geistigen Eigentums‹ war unbekannt. Im Gegenteil: Das Überarbeiten eines bekannten Vorbilds galt als lobenswerter denn das Erfinden eines neuen; und gern stellte man sich beim Kopieren gleichsam unter den Schutz eines altehrwürdigen Vorbilds.
(Für das Medium der Literatur vgl. dazu die Metaphorik der sammelnden Bienen hier.) ♦ In der Zeit vor dem Buchdruck lieh man sich eine Handschrift bei einem befreundeten Kloster aus, schrieb den Text ab und gab den Codex dann (oft auch) zurück. Dadurch kam niemand zu Schaden. Kommerzielle Überlegungen sind dann bei einem in der 1. Hälfte des 16. Jhs. aufkommenden Markt wichtig. Autoren wurden mit bescheidenen Honoraren abgefunden. Der Drucker/Verleger musste Leute entlöhnen, die eine Handschrift in einen lesbaren Text umwandeln konnten, sowie Korrektoren und (bei Sachbüchern) Verfertiger von Registern. Graphiker mussten (wenn auch gering) entlöhnt werden. Die Herstellung eines Buches von 300 bis 600 Exemplaren war eine teure Investition. Das Buch lag im Lager und wartete auf Käufer. Wenn ein anderer Drucker/Verleger merkte, dass ein Buch ein Erfolg war, konnte er sich solche Ausgaben sparen und einen Nachdruck auf den Markt werfen und Gewinn abschöpfen. Bereits Luther – der über eine Verbreitung seiner Schriften sehr erbaut war – wehrte sich gegen verfälschende Nachdrucke:
Zur Warnung vor einem Raubdruck beim Verleger Schott (1504) vgl. hier. Die Urheber versuchten beim regionalen Fürsten ein Drucker-Privileg zu bekommen. Bei der im Reich obwaltenden Kleinstaaterei (vgl. die Liste hier) konnte indessen der wenige Meilen weit im Nachbarstaat arbeitende Drucker ungestraft ›plagiieren‹. Georg Paul Hönn, Betrugs-Lexicon, worinnen die meiste Betrügereyen in allen Ständen nebst denen darwider guten Theils dienenden Mitteln entdecket, Coburg: Paul Günther Pfotenhauer und Sohn 1721:
Das britische Parlament verabschiedete 1735 ein Gesetz (Engraver’s Act) zum Urheberrechtsschutz für Kupferstiche. Das Gesetz geht auf die Initiative von William Hogarth zurück. 1837 setzte Preussen ein Urheberrrecht in Kraft: Julius Eduard Hitzig, Das Königl. Preußische Gesetz vom 11. Juni 1837 zum Schutze des Eigenthums an Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und Nachbildung. Dargestellt in seinem Entstehen und erläutert in seinen einzelnen Bestimmungen aus den amtlichen Quellen. Berlin: Ferdinand Dümmler 1838 .
♦ Bei manchen der schlecht kopierten Bilder möchte man mit Martial (Epigramme I,38) sagen:
Literaturhinweise: • Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Raubdruck • Horst Kunze, Über den Nachdruck im 15. und 16. Jahrhundert in: Gutenberg-Jahrbuch 1938, S. 135–143. • Hellmut Rosenfeld, Plagiat und Nachdruck, in: Archiv für Geschichte des Buchwesens 11 (1971), Sp. 337–372. • Hellmut Rosenfeld, Artikel »Plagiat« in: Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, zweite Auflage, dritter Band, Berlin 1977, S.114–126. • Gabriele Eva Maria Höfler, Nachdruck im 16. und 18. Jahrhundert Zur Vorgeschichte der Debatte um die digitale Raubkopie, Diplomarbeit der Philosophie (Mag. phil.), Wien 2011. • Anne-Kathrin Reulecke, Täuschend, ähnlich. Fälschung und Plagiat als Figuren des Wissens in Literatur und Wissenschaften. Eine philologisch-kulturwissenschaftliche Studie, Paderborn: Wilhelm Fink 2017 (469 S.). Erstes Beispiel: Der Augsburger Verleger Johann Schönsperger druckte bald nach der Erstausgabe der Schedelschen Weltchronik (1493) eine ›Volksausgabe‹ in kleinerem Format, sowohl lateinisch 1497 (Hain Repertorium bibliographicum # 14509) als auch deutsch 1496 (Hain 14511) und 1500 (Hain 14512). Man vergleiche das Vorbild hier mit dem Raubdruck derselben Seite: Liber cronicarum cum figuris et ymaginibus ab inicio mundi usque nunc temporis, a Iohanne Schensperger, Augsburg 1497 > http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/inc-iv-112 Die Forschung sagt, dass der Verkauf der Originalausgabe Schedels durch diese Nachdrucke stagniert sei. Zweites Beispiel: Das »Narrenschiff« »Das narren schyff« von Sebastian Brant (1457–1521) wurde in Basel bei Joh. Bergmann von Olpe zuerst 1494 gedruckt. Einen Teil der Holzschnitte hat man Albrecht Dürer (1471–1528) zugeschrieben. ••• Hier als Beispiel das Kapitel 20: Von schatz fynden [und den Fund unterschlagen]
Noch im gleichen Jahr erscheinen drei verschiedene Nachdrucke in anderen Verlagen sowie eine Überarbeitung mit neuen Holzschnitten. Hier wurde nur die Komposition des Bildes kopiert, es sind keine Abklatsche i.e.S. (Man kann diese Bilder auch unter dem Thema "stilistische Änderungen bei der Übernahme" abhandeln, siehe dort.)
Brant autorisiert eine lateinische Übersetzung seines Schülers Sebastian Locher (1471–1528), die 1497 erscheint und in der die ursprünglichen Holzschnitte übernommen sind: Stultifera nauis Narragonie profectionis nunquam satis laudata Nauis per Sebastianum Brant. vernaculo vulgarique sermone et rhythmo ... nuper fabricata/ Atque iam pridem per Jacobum Locher: cognomento Philomusum: Sueum: in latinum traducta […], [Basel: Johann Bergmann von Olpe 1497]. Vgl. Nina Hartl, Die »Stultifera navis«: Jakob Lochers Übertragung von Brants »Narrenschiff«, Teiledition und Übersetzung. Münster u.a.: Waxmann 2001. Diese lat. Ausgabe erscheint im gleichen Jahr 1497 mit vereinfachten Holzschnitten in Augsburg bei Johannes Schönsperger > http://diglib.hab.de/inkunabeln/548-quod-2/start.htm und diese Holzschnitte werden dann 1498 in eine deutsche Ausgabe übernommen:
Gänzlich umgearbeitet hat dieses Bild Tobias Stimmer (1539–1584):
Ebenfalls gänzlich umgearbeitet sind die Illustrationen zum Narrenschiff in diesem Buch:
Zur Druckgeschichte des »Narrenschiffs« vgl. Kommentar zum Narrenschiff hg. von Friedrich Zarncke, Leipzig 1854, S. LXXIX–CXVI Nikolaus Henkel, Sebastian Brant. Studien und Materialien zu einer Archäologie des Wissens um 1500. Verlag Schwabe 2021; insbes. Kapitel 10. ••• Drei Viertel der Bilder hat Thomas Murner (1475–1537) für seine »Narrenbeschwörung« (1512) aus dem »Narrenschiff« Sebastian Brants übernommen; die Texte hat er weitgehend selbst neu formuliert. Brant hatte das Druckmaterial bei seinem Umzug von Basel nach Straßburg (1501) dorthin transportieren lassen, wo er 1512 mit dem Drucker Matthias Hüpfuff die letzte von ihm betreute Ausgabe des »Narrenschiffs« anfertigte. Im selben Jahr ist bei Hüpfuff auch Murners Buch erschienen. Als Beispiel diene das Kapitel 39 aus Brant. Hier dient die Technik des Vogelfangs mit Netzen zur Illustration der Weisheit: Wer das Garn gut sichtbar ausspannt, um Vögel zu fangen, ist ein Narr. Gemeint ist: Sein Geheimnis, seine schlauen Absichten nicht verbergen ist töricht.
Wer öfflich schleht syn meynung an [anschlagen im Sinn von ausschreien]
Bei Murner dient für dieselbe Aussage, man solle seine Meinung nicht öffentlich verbreiten (Halt dyn anschlag heimlich still, Vers 56), der Affe, der, weil er keinen Schwanz hat, seinen Hintern zeigt. Dazu ist abgedruckt der Holzschnitt aus Brants Narrenschiff, wo ein Vogelfänger beim Netz hockt, dessen Hinterteil vom Bildrahmen verdeckt ist. (Das könnte den Anlass gegeben haben.)
In der Ausgabe 1518 wird das Bild dann ersetzt:
Literatur hierzu: Max Riess, Quellenstudien zu Murners satirisch-didactischen Dichtungen, Diss. Berlin 1890. M[eir] Spanier, Über Murners Narrenbeschwörung und Narrenzunft, in: Paul und Braunes Beiträge 18 (1894), S. 1–71. Thomas Murner, Narrenbeschwörung, hg. M. Spanier = Thomas Murners deutsche Schriften; mit den Holzschnitten der Erstdrucke; Bd. 2, Berlin / Leipzig: de Gruyter 1926 (hier Nr. 14 und Kommentar S. 305f.).
Drittes Beispiel: Gregor Reischs »Margarita« Diese Enzyklopädie erscheint das erste Mal 1503 bei Schott in Straßburg. Es erschien schon im Jahre 1504 bei Johannes Grüninger zu Strassburg ein Nachdruck.
In der Ausgabe 1504 werden die Druckstöcke nicht übernommen, sondern die Bilder neu geschnitten und dabei oft verändert. (Ob sie dabei korrigiert oder entstellt wurden, wäre ein interessantes Forschungsthema.) — Holzschnitt zu Beginn des VII. Buchs De principiis astronomiae: Die Personifikation der Astronomie lehrt den Ptolemaeus (Verfasser des »Almagest«) einen einfachen Sextanten handhaben.
Mehr zur »Margarita« von Gregor Reisch in einem eigenen Kapitel. Viertes Beispiel: Embleme von Zincgref Die Abgrenzung zwischen einer "späteren Neuauflage in einem anderen Verlag" und einem "Raubdruck" im engeren Sinne ist schwierig. Hier ein etwas komplizierter, ungeklärter Casus. Die erste Ausgabe von Emblematum ethico-politicorum centuria Julii Guilielmi Zincgrefii erschien 1619 Es gibt Neuauflagen 1624 und 1664, in denen die Kupfer von Matthäus Merian übernommen wurden. Emblem XVII zeigt einen Wolf in einem Kahlschlag mit der Moral, man solle den Krieg ins Land des Feindes tragen. Sic tandem proditur (So wird er schließlich entdeckt):
Die deutschsprachige Ausgabe im selben Verlag verwendet die originalen Kupferplatten; der Text ist typographisch realisiert:
Das Emblem wird als Zeichnung kopiert. Der deutsche Text wird handschriftlich übernommen. Die Vorzeichnung ist in der Zentralbibliothek Zürich überliefert: Sogar die Druckplatte ist überliefert. Der Text (der Ausgabe 1624) ist direkt in die Platte graviert, nicht mit Typen gesetzt:
Abzüge finden sich hinten eingebunden in: in Fünff und zwenzig bedenkliche Figuren mit erbaulichen Erinnerungen dem Tugend und Kunstliebenden zuo gutter Gedechtnus in Kupffer gebracht durch Conrad Meyer Mahler in Zürich... [1652 gemäss Zuschrifft] — ZB Zürich, Signatur OO 129 (unvollständiges Expl.) Die Signaturen in den Radierungen verweisen möglicherweise auf: • Nummern 3, 7, 10, 18: Johann/Hans J. Sulzer (Winterthur, 1631–1665); Sulzer hat auch einige Neujahrsblätter der Bürgerbibliothek Winterthur 1663/1664/1665 illustriert; • Nummern 6, 8, 14, 22: Heinrich Werdmüller (1630–1678).
Fünftes Beispiel: Conrad Meyer lässt sich inspirieren Der Maler Wilhelm Stettler (1642–1708) beschreibt in seinen autobiographischen Notizen, wie Conrad Meyer (1618–1689) eine bildnerische Anregung von ihm übernahm:
Die Radierung von C.Meyer ist – versehen mit Stettlers Spruch im kreisförmigen Rahmen sowie mit weiteren Bibelzitaten zum Thema – überliefert:
Sechstes Beispiel: Ovid-Illustration »Metamorphosen«, 10.Buch, Verse 8ff.: Der Sänger Orpheus erreicht von den Unterweltsgöttern, dass er seine verstorbene Gattin Eurydice wieder ins Leben zurückholen kann; er darf sich aber beim Gang in die Oberwelt nicht zu ihr zurückwenden – was er aber aus Liebe trotzdem tut, so dass Eurydice wieder in die Unterwelt zurückgeholt wird. Von Eurydice heißt es (Vers 48f.): sie war bei den neuen Schatten. (Hinten lässt der Zeichner den dreiköpfigen Cerberus kläffen; das Motiv ist Vergil, »Georgica« IV 481ff. entnommen).)
Ähnlich gestaltete bereits die Handschrift des »Ovide moralisé« die Szene:
Und so Adriaan Schoonebeek (1661–1705) :
Weitere Beispiele von Ovid-Plagiaten: Virgils Solis (1514–1562) kopiert (und verbessert!) in der Ovid-Ausgabe von Johann Spreng (Frankfurt 1563) die Holzschnitte von Bernard Salomon (1506 – 1510/1561) aus der Ovid-Ausgabe von Jean de Tournes, Lyon 1557. Johann Ulrich Krauß (1655–1719) kopiert mit seinen »Verwandlungen des Ovidii in zweyhundert und sechs und zwantzig Kupffern« die Bilder aus Isaac de Benserade, Métamorphoses en rondeaux, illus. Le Clerc / Chauveau / Le Brun, Paris, 1676. Johann Wilhelm Baur (1600–1642) kopiert mit den »Des vortrefflichen römischen Poëtens Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseon« die Bilder aus Melchior Küsel (1626–1683), Ovidii Nasonis Metamorphosis Oder Ovidii Des Poeten Wvnderliche Verendervng Verschidener Gestalden (1681). M.D.Henkel schreibt in seinem frühen, reichhaltig recherchierten Aufsatz: "Die Geschichte der Ovid-Illustrationen ist eine endlose Aufeinanderfolge von Wiederholungen, von Entlehnungen, von Diebstählen." (S. 60)
Siebentes Beispiel: Damokles unter dem Schwert wandert … Cicero erzählt in den »Gesprächen in Tusculum« (V,xxi,61–62) die Geschichte des Schmeichlers (adsentator, ein Nach-dem-Munde-Reder) Damocles. Der Hoffsuppenfresser Damocles wird von Dionysius zu einem Pancket eingeladen – da muste Damocles den obersten Orth einnemen/ da vber seinem Haupt ein scharpff Schwerd an einem Pferdshaar hienge/ als wolte es jetzund ihm auff den Kopff fallen. […] Damocles kondt vor grosser Forcht keinen Bissen essen oder trincken. (Text von J.L. Gottfried, s. unten). Horaz erwähnt die Geschichte ohne Namensnennung in Carm. (= Oden) III,i,17ff.: Wem über dem ruchlosen Nacken das gezückte Schwert hängt, dem werden sizilische Bankette keinen angenehmen Geschmack erwirken … (Übers. N.Holzberg) Das Bild hätte sich auch von einem deutschen Text inspiriert werden können: Das Buch »Flores virtutum. oder das buch der tugent« von Hans Vintler († 1419) liegt 1486 gedruckt vor. Hier ein Auszug: ains tages rueft im [dem nicht namentlich genannten Damokles] der chünig gerait | und fuert in auf sein chünegleichen tron […] danach nam er ain swert plos | und hieng das an ain roshar | auf sein haubt eben gar, | und lies vor im machen churzweil vil (in der Edition von I.Zingerle Verse 4440–4483). Sebastian Brant hat wohl dem Petrarcameister die Idee gegeben, das Kapitel über die Vergänglichkeit der Macht (1. Teil, Kap. 91) mit Damokles unter dem Schwert zu illustrieren; im Text von Petrarca wird der antike Mann nicht erwähnt:
1620 veranstaltet Eberhard Kieser (tätig 1612–31) einen Neudruck des 1. Teils des Glücksbuches von Petrarca, in dem er die Holzschnitte in Radierungen/Kupferstiche umarbeitet. Hier wird das Vorgängerwerk im Buchtitel erwähnt.
Paolo Maccio (1576–1623?) verwendet den ursprünglichen Holzschnitt wenig verändert und ebenfalls als Kupfer in seinem Emblembuch mit dem Motto Che nell’imperio non è sicurrezza alcuna:
Horaz spielt (Oden, Buch II,i,17ff,) auf diese Geschichte an: Wem über dem ruchlosen Nacken das gezückte Schwert hängt, dem werden sizilische [luxuriöse] Bankette keine süße Leckerei darbringen. Diese Verse (Districtus ensis cu super impia cervice pendet …) sind der Anlass für das Emblem im Emblembuch von Otto van Veen (1556–1629):
In der deutschen Ausgabe ist das Bild (wie üblich seitenverkehrt) kopiert:
Matthäus Merian d.Ä. (1593–1650) übernimmt das Bild von Otto van Veen mit leichten Änderungen und passt es dem Querformat an (hier besser als bei E.Kieser 1620):
Auch Wenzel Hollar (1607–1677) kennt das Bild:
In diesem populären Geschichts-Buch wird das Bild ebenfalls kopiert:
Achtes Beispiel: Scheuchzers »Physica Sacra« Die Vorlage:
••• 1733 druckt der Augsburger Verleger Johann Simon Negges (1726–1792) eine Bilderbibel mit 498 Bildtafeln, die aus der »Physica Sacra« übernommen sind. Die Texte sind weggelassen. Die Numerierung der Tafeln oben rechts ist getilgt. — Negges zitiert Scheuchzer mit keinem Wort. (Negges ist ein Verwandter von Andreas Pfeffel, dem Herausgeber der ursprüngliche Ausgabe.)
••• In Konstanz arbeitete der Benediktiner Germanus Cartier (1690–1749) an einer neuen, katholischen deutschen Bibelübersetzung mit Kommentar. Sie erschien zuerst (zweispaltig, bebildert) 1751, dann neu 1763, dann – wieder mit veränderten Illustrationen – 1770. Das Buch enthält 65 [?] Kupfertafeln aus Scheuchzers »Physica Sacra«; sie sind aber neu gefertigt.
Ein Beispiel: Scheuchzer verwendet die Bibelstelle des Opfers von Kain und Abel (Genesis 4,1–24) für das Thema der Erkenntnis von Emotionen aus der Physiognomie. Der Ackerbauer Kain opfert Gott Früchte, sein Bruder Abel, der Hirt, opfert Schafe, und Gott zieht dieses Opfer vor. Vers 5 heißt es: Da ergrimmte Kain und sein Angesicht verfiel ihm [in anderer Übersetzung:] sein Gebährde verstellete sich. Scheuchzer zeigt im Inneren der Tafel XXXIII die Szene der beiden Opfernden und in der Umrandung sechs typische Physiognomien: 1 Traurigkeit – 2 Andacht oder Frömmigkeit – 3 Freude – 4 Verzweifflung – 5 Haß / Zorn – 6 Neid. (Für die Darstellung sind die Studien von Charles Le Brun Pate gestanden.) Links: Neben Kain zeigt Scheuchzer das Gesicht des Neidischen (6) – Rechts: Der Nachdrucker lässt das weg und setzt einen ornamentalen Rahmen hin:
rechts: https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb11175103?page=39 Die Kopien sind sehr exakt gearbeitet. Eine Übernahme der Kupferplatte ist schwer denkbar, wo die in das Bild hineinragenden Rahmen neu gestaltet wurden, was im Tiefdruckverfahren kaum möglich ist. Unter der Lupe sind denn auch Unterschiede zu erkennen; vgl. insbesondre das Gesicht Kains! Bei Tafel CLIX (im Original) zu Exodus XVI, 4–35 = Sammlung des Manna besteht kein Zweifel: Das Bild in der Neufassung ist seitenverkehrt.
Neuntes Beispiel: Die »Encyclopédie« 1765 erscheint der letzte Text-Band in Paris; 1772 erscheinen die letzten der 11 Tafelbände, 1777 das Supplément. — Bereits 1770–1778 wird in der Druckerei von Marco Coltellini und Giuseppe Aubert in Livorno ein Raubdruck (une contrefaçon) hergestellt: 17 Textbände (1769–1775) und 11 Bildbände (1771–1778): Troisiéme édition enrichie de plusieurs notes dédiée à Son Altesse Royale monseigneur l'archiduc Pierre Leopold prince royal de Hongrie et de Boheme, archiduc d'Autriche, grand-duc de Toscane &c. &c. &c, A Livourne de l’imprimerie des éditeurs … Die Kupfertafeln (Planches) werden präzis nachgestochen. |
||
Exkurs: Kunst-Kopie••• Berühmte Bilder wurden immer wieder reproduziert. Es gibt unüberschaubar viele Kopien der im 17.Jh. gedruckten Kupferstiche/Radierungen. Bei Originalen ist unten der Zeichner (inv., inven., invenit = hat entworfen, oder del., delin., delineavit = hat gezeichnet ) und der Stecher/Radierer (sculpsit = hat in Kupfer gestochen bzw. radiert) und oft auch der Drucker/Verleger (excudit, excudebat) angegeben. • Diese Bilderbibel ist mit 130 Kupfern illustriert, wozu die Vorlagen von berühmten zeitgenössichen Künstlern (Veronese, Peter Paul Rubens, Anthonis van Dyck, Elsheimer, Giordano, Veronese, Tintoretto, Rubens, Poussin u.a.) stammen. Die Kopien sind signiert von Philipp Andreas Kilian (1714–1759); jedes Bild enthält einen Verweis auf das Original z.B. P.Picart del.
• David Teniers (1610–1690) publizierte 1660 das »Theatrum Pictorium«, in dem 243 (den Künstlern zugeordnete) Reproduktionen in Kupfer abgebildet sind:
• Im folgenden Beispiel erkennt man gut die technische Vergröberung bei einer Kopie:
• Tizian ließ ab 1566 nur noch Stiche unter seiner direkten Kontrolle anfertigen. Außerdem erwirkte er im gleichen Jahr bei der Signoria ein Monopol für den Vertrieb seiner Stiche, womit er verhindern konnte, dass minderwertige oder fehlerhafte Stiche seiner Werke verbreitet bzw. verkauft wurden und sein Ruf dadurch geschädigt würde. https://de.wikipedia.org/wiki/Tizian • Rubens (1577–1640) beschäftigte eine Gruppe junger Kupferstecher die seine Bilder von 1610 an in den Druck umsetzten; diese schulte und überwachte er persönlich. So entstanden etwa 100 Reproduktionen. Vgl. dazu: Ariane Mensger (Hg.), Déjà-vu (2012) S. 190. • Giovanni Giacomo de Rossi (1627–1691) fertigte Kupfer-Blätter der Bilder von Raffael in den Loggien des Vatikans an:
• Nicolas Dorigny († 1746) fertigte 1711–1719 auf Einladung von Queen Anne Kopien der Kartons an, die Raffael 1515/1516 als Vorlagen für die Tapisserien in der Sixtinischen Kapelle geschaffen hatte. Beispiel: Der wunderbare Fischzug (259 x 319 cm): ••• Es wurden auch Bilder, Bilderserien, Bücher eigens als Vorlagen für die Wiederverwendung hergestellt. In den Titeln vieler Bücher (unterschiedlicher Thematik) wird darauf verwiesen, dass die darin erscheinenden Bilder als Vor-Bilder für weitere Verwendung gedacht sind. Einige Beispiele:
Ein Beispiel ist die Kupferstichserie von Joris und Jacob Hoefnagel:
••• Popularisierung, pädagogische Bereitstellung von Bildern • Im »Magasin Pittoresque« erscheinen immer wieder Reproduktionen. Hier aus einem Artikel Éditions incunables, in dem u.a. ein Holzschnitt aus der »Hypnerotomachia Poliphili« gezeigt wird:
•Im »Pestalozzikalender« (Schweizer Schüler-Kalender) gab es alljährlich eine Rubrik mit Reproduktionen, wenige davon farbig.
• Reproduktionen wurden auch im akademischen Unterricht gebraucht. Hier Prof. Jacob Burckhardt mit einer Mappe voller Repros 1878 auf dem Weg zur Vorlesung > https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/011647/2012-03-12/
••• Ferner ist darauf hinzuweisen, dass das ehrfürchtige Kopieren von Bildern berühmter Meister ein wichtiges Element in der Kunstausbildung war. Vgl. dazu Hier ein Ausschnitt des Bilds von Kunst-Studentinnen und Kunst-Studenten im Louvre von Winslow Homer, der sich 1867 in Paris aufhielt: |
||
Weitere Beispiele:••• Das Meerschwein (Porcus marinus), das von 1537 bis 1578 abgebildet wird und dabei mehrfach das Medium wechselt. (Website der Schweizerischen Gesellschaft für Symbolforschung) ••• Der Kampf zwischen Nashorn und Elefant (Website der UZH) ••• Zählebige, persistente Bildtraditionen (Beispiele: Salamander; Lawinen; der Tellenschuss; der Forstteufel) ••• |
||
ErkenntniswertWas erhellt aus der Untersuchung solcher Bildreihen? ➔ Man ersieht die – oft unzimperliche – Vorgehensweise von älteren Verlegern. (Heinrich Steiner und Sigmund Feyerabend waren die prominenten Beispiele). ➔ Bei Bildern in frühen Drucken handelt es sich nicht zwingend um mimetische Abbildungen (wie etwa bei einer Stadtvedute), sondern oft um eine Art Pictogramm (Beispiel: die Schlacht, das Erdbeben, das hohe Gebäude). ➔ Man erkennt die missliche Lage früherer Wissenschaftler, die ihre Werke illustrieren wollten, aber nicht immer Bilder nach eigener Anschauung zeichnen konnten und deshalb auf Vorlagen zurückgreifen mussten. (Das prominenteste Beispiel ist die deutsche Plinius-Ausgabe 1565, wo Bilder aus Bibeln und der antiken Mythologie und anderswoher übernommen wurden.). ➔ In früheren Zeiten hatte man offenbar für Zuordnungen zu literarischen oder ikonographischen Gattungen ein schwach ausgeprägtes Bewusstsein: Texte und Bilder wurden per ›copy paste‹ gelegentlich auch von einem Werk einer bestimmten Gattung in ein Werk überführt, das wir heutzutage einer anderen Gattung zuordnen würden. Dabei ändert sich die Aussage, die Pointe des Bilds; es illustriert im neuen Kontext etwas anderes: Thema ist z.B. nicht mehr der Stolz der Frau, die sich im Spiegel betrachtet, sondern der Spiegel, der einmal erfunden worden ist. (Die Migration von Flugblättern und Ovid- und Aesop-Illustrationen in zoologische Werke sowie die Illustration des sachkundlichen Beitrags über die Simonisten mit dem Bild aus einem Roman waren die prominenten Beispiele). ➔ Anhand von Bild-Übernahmen lässt sich ein stilistischer Wandel erfassen. Der Stilwandel kann so weit gehen, dass die ursprünglich intendierte Aussage verwischt wird. (Beispiel war das Emblembuch von Steinkopf 1855). ➔ .... |
||
LiteraturhinweiseAlfred W. Pollard (1859–1944), Old Picture Books. With other Essays on Bookish Subjects, Methuen 1902; darin: The Transference of Woodcuts in the 15th and 16th Centuries (1896). »Meister borgen bei Meistern«, Kulturelle Monatsschrift du, 21. Jahrgang, Mai 1961 [Beiträge verschiedener Autoren; vgl. hier > http://doi.org/10.5169/seals-293812] Arnold Esch, Spolien. Zur Wiederverwendung antiker Baustücke und Skulpturen im mittelalterlichen Italien. In: Archiv für Kulturgeschichte Bd. 51 (1969) S. 1-64. Donat de Chapeaurouge, Wandel und Konstanz in der Bedeutung entlehnter Motive, Wiesbaden: Steiner 1974. Reinhard Wittmann, »Der gerechtfertigte Nachdrucker«. Nachdruck und literarisches Leben im 18. Jahrhundert. In: Giles Barber, Bernhard Fabian (Hgg.): Buch und Buchhandel in Europa im 18. Jahrhundert. (Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens 4), Hauswedell, Hamburg 1981, S. 292–320. Nils-Arvid Bringéus, Volkstümliche Bilderkunde, München: Callwey 1982. (insbes. Kapitel 6: Bildstabilität und Bildvariation S. 102ff. mit dem Beispiel des Motivs "Altweibermüle") Bernd Schneider, ›Virgilius pictus‹. Sebastian Brants illustrierte Vergilausgabe von 1502 und ihre Nachwirkung. Ein Beitrag zur Vergilrezeption im deutschen Humanismus, in: Wolfenbütteler Beiträge Bd. 6 (1983) S. 202–262. Margrit Früh, Die herausgeschnittenen Ittinger Miniaturen des 17. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 50 / 2 (1993), S. 121 - 144 mit 15 Ill. (Digitalisat hier) Peter Schmidt, Gedruckte Bilder in handgeschriebenen Büchern. Zum Gebrauch von Druckgrafik im 15. Jahrhundert Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2003 (Pictura et poesis, Band 16 ) > https://doi.org/10.7788/9783412324889 Arnold Esch, Wiederverwendung von Antike im Mittelalter. Die Sicht des Archäologen und die Sicht des Historikers. Berlin 2005 (60 Seiten). Dietmar Peil, Tradition und Irrtum. Über Fehler und Varianten bei der Emblemrezeption. In: Peil, Ausgewählte Beiträge zur Emblematik, Hamburg: Kovač 2014, S. 143–171. [Erstdruck englisch 2005] Matthias Oberli, Schlachtenbilder und Bilderschlachten. Kriegsillustrationen in den ersten gedruckten Chroniken der Schweiz, in: Anfänge der Buchillustration = Kunst + Architektur in der Schweiz […], Jahrgang 57 (2006), 45–53. Digitalisiert von e-periodica > http://doi.org/10.5169/seals-394330 Jörg Jochen Berns, Künstliche Akzeleration und Akzeleration der Künste in der Frühen Neuzeit (zuerst 1997), in ders.: Die Jagd auf die Nymphe Echo. Zur Technisierung der Wahrnehmung in der Frühen Neuzeit, Bremen: Edition Lumière, 2011, S. 111–135. Reproduktion. Techniken und Ideen von der Antike bis heute. Eine Einführung. Hg. von Jörg Probst. Berlin: Reimer 2011. Nikolaus Henkel, Das Bild als Wissenssumme. Die Holzschnitte in Sebastian Brants Vergil-Ausgabe, Straßburg 1502; in: Stephen Mossman [et al., Hgg.], Schreiben und Lesen in der Stadt. Literaturbetrieb im spätmittelalterlichen Strassburg, Berlin: De Gruyter 2012, S. 379–409. — Nikolaus Henkel, Sebastian Brant. Studien und Materialien zu einer Archäologie des Wissens um 1500. Verlag Schwabe 2021; Kapitel 12.4 = S. 607–645. Ariane Mensger (Hg.) Déjà-vu? Die Kunst der Wiederholung von Dürer bis YouTube, Bielefeld: Kerber 2012 (Katalog zur gleichnamigen Ausstellung in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe 2012 mit 12 wiss. Aufsätzen und einem Katalog von 100 Werken) Paul Michel, Habent sua fata picturæ. Rezyklierte Bilder in Büchern des 16.Jahrhunderts, in: LIBRARIVM, Zeitschrift der schweizerischen bibliophilen Gesellschaft 2019, Heft I, S. 26–39. Paul Michel, Der Petrarcameister, rezykliert, in: LIBRARIVM, Zeitschrift der schweizerischen bibliophilen Gesellschaft 2021, Heft II, S. 2–15. [anonym] Zusammenstellung von Holzschnitten von Jost Amman in Originalen und Kopien Zu Überarbeitungen von Bildern in Bibeln |
||
|
Erste Fassung online gestellt von P.Michel, Mai 2016; letzte Ergänzungen im Mai 2023. |
||