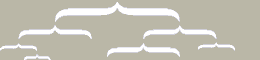
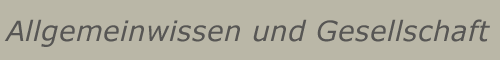
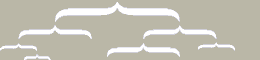 |
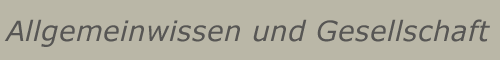 |
Persistente Bilder |
| zurück zur Seite Visualisierung von Wissen Zählebige BildtraditionenZu über längere Zeiten hinweg sich stabil erhaltende Denkformen, zum Primat von gedanklichen Konzepten, sedimentierten Wissensmustern usw. ist schon viel nachgedacht und geforscht worden. Einige Hinweise:
Hier konzentrieren wir uns auf Faktizitätskonstruktion mittels Bildern. Ist ein Bild einmal prägnant formuliert, so kann es persistent, zählebig und oft unreflektiert tradiert werden; es hält sich als "Sinn-Offerte" im kulturellen Gedächtnis, oft auch gegen die Empirie. Man könnte von "Bildschablonen" sprechen. — Wenn zum Bild eine einprägsame Geschichte dazukommt, hält sich die Tradition noch stärker. Übersicht: Von solcher Kolportage zu unterscheiden ist das mit Bedacht (z.B. zwecks Übernahme von Konnotationen, Travestie, Parodie) verwendete Zitat. Als Beispiel hier: der Bayblonische Turm Ähnliche Materialien dazu im Kapitel zu den von Buch zu Buch wandernden Bildern.
|
||
Der SalamanderDer Salamander hat abenteuerliche Wanderungen durch die Literatur hinter sich: aus der mythologischen Erzählung und vom Reisebericht ins naturwissenschaftliche Werk und ins Emblembuch. Im Hintergrund muss man eventuell folgende Geschichte dazudenken: Ovid erzählt (Metamorphosen 5,446ff.): Die Göttin Ceres gelangt auf der Suche nach ihrer Tochter Cyane zu einer Hütte, wo ihr eine alte Frau ein Getränk zur Erfrischung reicht. De tritt ein frecher Knabe zu ihr und beschimpft sie. Die Göttin spritzt das mit Gerste vermischte Getränk auf den Spötter, und dieser wird in eine Echse (lacerta) verwandelt; sein Rücken ist davon wie mit verschiedenen Sternen gesprenkelt, wozu sein Name passt: nomen habet variis stellatus corpora guttis (Vers 461).
Plinius (nat. hist. X, lxxxvi 188 ) beschreibt den Salamander als mit einer sternartigen Zeichnung versehen (stellatus). Er ist so eiskalt, dass er durch bloßes Berühren das Feuer auslöscht:
Bernhard von Breydenbach (1440–1497) erwähnt das Tier in seinem Reisebericht; lässt es abbilden und sagt dazu: Hec animalia sunt veraciter depicta sicut vidimus in terra sancta (Diese Tiere sind wahrhaftig so gezeichnet, wie wir sie im heiligen Land gesehen haben).
Gregor Reisch († 1525) lässt sich das Tier in seiner Enzyklopaedie 1503 nicht entgehen. Der Salamander entsteht aus dem Wasser, kann aber auch im Feuer leben (Augustin, Civitas Dei 21,4). Plinius sage von ihm (nat. hist. X, lxxxvi, 188), das Tier habe die Gestalt einer Eidechse und lösche Feuer, das es berührt, wie Eis:
Sebastian Münster übernimmt den Druckstock tel quel in seine »Cosmographie«, wo er von den Ländern Asiens spricht: do findt man auch die schlang Salamandra genent/ die im feüwer on schaden oder verletzung gleben mag. Man braucht disse schlang zuo etlichen tüechern/ vnd die werden so werhafft daruon das sie in keinem feüwer mögen verbrennen/ sunder so sie onsauber werden wirfft man sie ein stund in das fewer/ vnnd nimpt sie sauber als werden sie gewäschen on verletzung wider darauß.
Im selben Verlag erscheint dann das Buch von Conrad Lycosthenes (1518–1561), wo zu Beginn die Rede ist Von vnergründtilchen wunderwercken Gottes/ die er syd angebinn der Welt in seltzamen geschöpffen/ mißgeburten […] den mentschen zur anmhanung/ schrecken […] fürgepracht. Dasrunter kommt auch der Salamander vor; der Holzschnitt ist dem Buch von S.Münster entnommen:
1545 wandert der Salamander auch in die zoologische Fachliteratur. Salamandra, ein gifftiger wurm – von ihm findet man gar mancherlei Opiniones oder viler handt widerwertige meinungen bei den alten erkundigern natürlicher ding … – Der Text ist übersetzt aus Albertus Magnus (wie oben).
Conrad Gessner (1516–1565) übernimmt das Bild mit zweifelnden Bemerkungen in die auf Bilder konzentrierte Zoologie »Icones animalium« (1553). 1557 schreibt er an Caspar Wolf (1532–1601, damals in Montpellier), er habe gehört, dass im Languedoc ein Salamander vorkomme, der eine Art Sternchenmuster auf dem Rücken habe. Er bittet ihn, diese Art mit seinem Bild zu vergleichen und, falls sie davon abweiche, eine Zeichnung davon verfertigen zu lassen. (Hinweis bei Urs B. Leu, Conrad Gessner, Zürich 2016; S. 207 und Anm. 880). In der zweiten Auflage (1560) vermerkt er deutlich: Salamandrae figura falsa. Es sei ein Fake von Unwissenden oder gar Unverschämten:
Auf der Reise noch ›Ost‹-Indien haben Jan Huygen von Lintschotten und andere 1598/99 auch einen solchen Salamander angetroffen und bald publiziert:
In einer (anonym gedruckten) Reisebeschreibung 1606 erscheint der Salamander auf einer Kopie des Holzschnitts von Breydenbach. Angetroffen wurden diese Tiere in Gazara im Heiligen Land!
Das Buch von Edward Topsell (ca. 1572–1625) erschien zuerst 1607. Er zitiert eine riesige Fülle von mythologischen, phantastischen und naturkundlichen Quellen.
Der vom Feuer umgebene Salamander ist das Wappentier des Königs François Ier (1494 –1547). Das zur Devise gehörige Motto: Nutrisco et extinguo (Ich ernähre mich [davon] und ich lösche [es] aus) wird gemäß Claude Paradin (1512–1573) so verstanden:
Das Tier überlebt, nur wenig mutiert, in der Emblematik und in der Alchemie. Bei Joachim Camerarius (1534–1598), in »Symbola et emblemata« Band IV (1604), Nummer 49 zitiert er die antiken Quellen und fasst den Salamander aus alsBild der Beständigkeit.
Dieselbe Symbolik hier:
Ganz anders wird der Salamander gedeutet im Fürstenspiegel von Diego de Saavedra Fajardo (1584–1648), »Idea de un principe politico christiano« (1640). Die Heuchler [in der span. Vorlage: aduladores] werden mit verschiedenen Naturdingen vergleichen, darunter:
Unter der Bezeichung ›Chamäleon‹ erscheint der Salamander mit derselben Devise – und einer spaßigen französischen Übersetzung – in diesem Emblembuch:
Alchemie:
Bibel: Unter den unreinen Tieren zählt das Buch Leviticus (3.Mos.) 11, 29/30 fünf Kriechtiere auf (wovon drei nur hier vorkommen, hapax legomenon). Übersetzer tun gut daran, einfach die hebräischen Namen stehen zu lassen: der Zab, die Anaka, der Koach, der Letaah, der Chomet. Johann Jacob Scheuchzer tut sich schwer, diese mit lebenden Tierarten zu identifizieren. (Ein altes Problem: Dieselbe Tierart heißt in verschiedenen Sprachen anders, und dieselbe Bezeichnung wird für verschiedene Tiearten verwendet.) Zum Tier mit dem hebräischen Namen ’anaqah hat er sich umgesehen, er vermutet: eine Gattung von Eydexen. Sein Graphiker ist weniger zauderlich und setzt einen gestirnten Feuersalamander ins Bild:
Tatsächlich gibt es eine Echse Hardun (Stellagama stellio), das ähnlich aussieht, vgl. diese Bilder:
Nachklang: Goethe, Faust II. – Kaiserliche Pfalz. – Lustgarten (Verse 5989ff.):
Literaturhinweis: Artikel "Salamander" von Katja Weidner auf >>> https://www.animaliter.uni-mainz.de/salamander/ |
||
LawinenDie Vorstellung, eine Lawine sei eine riesige Schneekugel, die bergabwärts rollt und alles in sich hineinwickelt, ist falsch. Zum »Theuerdank« (1517) vgl. oben. Hier bringt Unfalo Tewerdannckh in Gefahr, indem er ihn mit der Aussicht auf gute Jagdbeute in die Berge lockt und heimlich einen Diener ausschickt, der mit Schneebällen eine Lawine auslöst. Er befiehlt ihm: So mach von schnee einen pallen | Unnd lass den gmach herab fallen | Das daraus werd eine leenen [Lawine] gross | Dieselb den Helden zuotodt stoss. – Dann: Als der knecht ersach den Tewrn man| macht Er pald ein pallen von schnee | derselbig lieff hinab vnnd ee | Er halben weg geloffen was | wurd der pall von schne so gross/ das | Er het mögen mit der grös sein | Bedecken ein gemeins stetlein …
Johannes Stumpf beschreibt 1547, dass der weiche Schnee im Frühling oft von einem warmen Wind oder durch einen Vogel oder einen Ton bewegt wird, das er anfacht ein wenig rysen/ vnd zestund meeret er sich zuo einem sölichen hauffen/ das er gegen tal laufft/ vnd stoßt vor jm hin grund/ boden/ böum/ erdtrich/ velsen/ vnd alles das er begreyfft/ also das sölicher schneebruch einen gantzen fläcken oder dorff … hinstiesse vnd verdecke. […] Und söliche Schneebruch werdend vom landvolck genennt ein Lowin. — Von einer Kugelgestalt ist im Text nicht die Rede; hingegen zeigt das Bild sie:
Wenn Johann Jacob Wick (1522–1588) über ein Lawinenunglück 1563 berichtet, zeichnet er dieses Bild ab:
Johann Jacob Scheuchzer (1672–1733) kennt die Lawinen sehr genau aus Berichten von Einwohnern der Dörfer, die er auf seinen Bergreisen getroffen hat. (Am bequemsten einsehbar in der postumen Ausgabe: Johann Jacob Scheuchzers, Weyland Profess. der Natur-Lehre und Mathematic / Canonici in Zürich […] , Natur-Geschichte des Schweitzerlandes, Samt seinen Reisen über die Schweitzerische Gebürge. Aufs neue herausgegeben, und mit einigen Anmerkungen versehen von. Joh. Georg Sulzern, Zürich: David Gessner 1746. Erster Theil S. 294–307; Zweyter Theil S. 343-350.) – Ein Text besagt beispielsweise: So fienge sogleich der Himmel an dunckel zu werden, und hat sich gleichsam in einem Augenblick der Schnee von dem Berg gelößt, und nachdem er die Bäume mit den Wurtzeln, Felsen und alles was ihm in den Weg stunde, mit Ungestüme und Gewalt mit sich fortgerissen, […] Die Vorstellung des Schneeballs gebraucht er nicht. Bilder hat er nicht beigegeben. David Herrliberger (1697–1777) exzerpiert Scheuchzer in seinem Buch über die Eidgenossenschaft. Bemerkenswert ist eine kleine Änderung, die er an einem Text von Scheuchzer vornimmt:
Diese Textvariante fördert die bzw. stammt von der Bild-Idee:
Herrlibergers Vorlage, eine Zeichnung von Daniel Düringer, ist abgebildet bei Hermann Spiess-Schaad, David Herrliberger, Zürich: Verlag Hans Rohr 1983; S. 78.
Die ›Kenntnisse› werden auch in eine Enzyklopädie übernommen. Aus dem langen Artikel in Krünitz dies: Eine Schnee= oder Berg=Lauwine, ein Klumpen Schnee, welcher von den steilen Bergen rollt, sich im Herabfallen vergrößert, und oft ganze Häuser und Dörfer bedeckt. Und S. 462: Zu der Zeit, da das ganze Gebirge mit frischem Schnee bedeckt ist, werden zuweilen kleine Schnee=Schollen von dem Winde über den Rand der Firne und Schnee=Bänke hingetrieben, rollen sich dann über den Abhang des Gebirges hernieder, und nehmen im Fortwälzen immer zu. Mit ihrer Vergrößerung wächst auch die Macht des Druckes, den sie auf alles, was ihnen in Wege ist, äussern; sie reissen es mit sich fort, oder treiben es vor sich her, bis sie endlich auf einer Ebene stille stehen.
1813 dann ein realistisches Bild:
Die Tradition lebt indessen weiter:
Literaturhinweis: Bruno Weber, Lawinen über Leukerbad. Historiographie und Quellenkritik, in: Blätter aus der Walliser Geschichte, 2010, Nr.. 42, S. 23–64. |
||
Der Forstteufel1531 erscheint ein Flugblatt, das ein in der Nähe von Salzburg gefundenes Tier (Beste) zeigt und (auf französisch) beschreibt — Abbildung bei Ingrid Faust, unter Mitarbeit von Klaus Barthelmess u.a., Zoologische Einblattdrucke und Flugschriften vor 1800, Stuttgart: Hiersemann 1998–2010; Band V, Nr. 760. Conrad Gessner (1516–1565) bringt im Tierbuch (lateinische Ausgabe 1551) im Kapitel De Satyro die Geschichte vom Forstteüfel, der dannzumal im Bisthuomb zuo Saltzburg/ im Hanßberger Forst beobachtet worden sei. Wiewol dises thier von niemants mer gesehen worden/ dann eben zuo vnsern zeyten/ vnd gefangen im jar nach Christi geburt M.D.XXXI. [… ist es] on zweyfel ein erschrockenliche bedeütliche wundergeburt gewesen. (Forrers Übersetzung 1563) – Er hat es auf dem Flugblatt kennengelernt, das ihm Georg Fabricius samt einer Beschreibung zugesandt hat (Hist. Anim. I, S. 979: Satyrorum historiæ subijciendum duxi monstrum illud, cuius effigiem apposui, quem eximiæ eruditionis & humanitatis uir Georgius Fabricius ex Misnia Germaniæ ad nos misit & simul descriptionem).
Das Lebewesen macht sodann Furore: Conrad Lycosthenes nimmt es selbstverständlich gerne in seine Prodigiensammlung 1557 auf:
Johann Jacob Wick (1522–1588) lässt es für seine Prodigiensammlung zum Jahr 1531 aus Gessners Buch abzeichnen, wiewol dises thier von niemands mer gesähen worden, dan eben zuo unseren zyten, und gefangen im iar nach Christi geburt 1531. Er schreibt dem Wesen auf den Leib: o du käzer.
Pierre Boaistuau übernimmt es in seinen »Histoires Prodigievses« (1568). Das Wesen wandert auch wieder zurück in die zoologische Fachliteratur: Die Plinius-Übersetzung (1565) bringt das Bild im Kapitel Von etlichen wunderbarlichen Thieren/ die im Mohrenland vnd in India jhr wohnung haben (entsprechend Plinius nat hist VIII,xxx,72ff) als Jungkfrauwaff. Und er zitiert dazu das Emblembuch von Andrea Alciato, wo jener die Sphinx allegorisch auslegt!
(Nicht eingesehen: die Lizentiatsarbeit zum Forstteufel von Philipp Stähli, Universität Zürich 2014.) |
||
Der Tellenschuss»Für jede Nation verdichtet sich ihre historische Herkunft in erregenden Geschichten […]. Diese Geschichten haben eine eminente Funktion. Denn sie sind in ihrem Wesen politische Verhaltensanweisungen. […] In ihnen erscheint elementar der politische Wille dieses Landes. [Zur Geschichte von Wilhelm Tell:] Der Gehorsam im Staat hat seine Grenzen. Untertanengeist darf nie überhandnehmen.« (aus: Peter von Matt, »Plädoyer für die Heldensage.« in: NZZ am Sonntag 2. August 2009) »Ob Wilhelm Tell gelebt hat, weiß man nicht. Aber daß er den Landvogt Geßler umgebracht hat, steht fest.« (Hans Weigel, Lern dieses Volk der Hirten kennen. Versuch einer freundlichen Annäherung an die Schweizerische Eidgenossenschaft, Artemis-Verlag 1962 ) Saxo Grammaticus, Gesta Danorum X,7 (um 1200):
• Der Rütlischwur und die Tellsgeschichte erscheinen im Weißen Buch von Sarnen (zwischen 1470 und 1472 geschrieben) das erste Mal. • Die Szene mit dem Apfelschuss von Wilhelm Tell wird in der Bilderchronik von Petermann Etterlin (1507) – der frühesten gedruckten Fassung des Stoffs – erstmals visualisiert.
• Denselben Druckstock verwendet der Basler Drucker Heinrich Petri in der »Cosmographie« von Sebastian Münster (evtl. schon vorher?) im Kapitel Von den vögten in den ländern Vry/ Schweytz/ vnd wie etliche auß denselbigen vertriben worden: Cosmographia. Beschreibung aller Lender durch Sebastianum Munsterum in wölcher begriffen. Aller völcker Herrschafften, Stetten vnnd namhafftiger flecken / härkom(m)en…. Allenthalben fast seer gemeret und gebessert / auch mit einem zuogelegten Register vil breüchlicher gemacht. Basel, Heinrich Petri, 1546, pag. ccxciij. • Christoffel Froschauer kennt das Motiv und verwendet es in einer Initiale bereits 1523 (nach Paul Leemann van Elck, Die Offizin Froschauer, Zürich 1940, S. 174) und dann seltsamerweise in den deutschen Bibeln 1525 und 1531:
• Im »Büchle, genannt Memorial der Tugend« soll dargelegt werden, dass der Hochmut des Amptman bewirkte, dass der schweitzer bund erweckt wurde; woraus die Sentenz gezogen wird: Darumb wer herrscht durch forcht on lieb/ Der luog das er kain kurzen schieb [aus dem Kegelspiel: das Ziel nicht erreichen]. Der Verleger des »Teütsch Cicero« (von dem das Memorial der Tugend ein Bestandteil ist) – Heinrich Steiner in Augsburg – lässt 1534 das Bild von Hans Leonhard Schäuffelein in Holz schneiden (unten rechts signiert):
Bilder aus dem Buch wurden bald danach neu gezeichnet:
• Die Szene darf selbstverständlich in der Stumpffschen Chronik (erste Exemplare erscheinen 1547) nicht fehlen. Im 4. Buch, 53. Kapitel wird der Anfang der Eydgnoschafft behandelt. Jetzt ist der Hut auf der Stange sichtbar, und im Hintergrund erkennt man (im Stil der narrativen Simultanbilder), wie Tell vom Boot springt und dann in der Hohlen Gasse mit der Armbrust den reitenden Landvogt erschießt.
• Selbstverständlich erscheint das Bild im Tellenspiel von Jacob Ruf (1505–1558) 1545:
In der Ausgabe 1563 erscheint die Szene schon auf dem Titelblatt und dann im Inneren:
• In der Sammlung von Johann Jakob Wick (1522–1588) erscheint die Szene auch (linke Bildhälfte).
• In späteren Auflagen der Münsterschen Cosmographie (1567; schon früher?) ist das Bild von Hans Rudolf Manuel Deutsch (1525–1571) gestaltet; vgl. die Signatur HRMD. Auch hier im Hintergrund die Szene, wo Tell auf Gessler zielt.
• Miniatur
• Scheibenriss von Hans Heinrich Wägmann (1557–1628) 1580:
• Derselbe Maler dann nach 1606 in der Kapellbrücke Luzern:
• 1613 erscheint erstmals das Tellenlied von Hieronymus Muheim (1605–1610 Landschreiber von Uri):
• Im Geschichtsbuch von Johann Ludwig Gottfried (1584–1633) ist die Szene illustriert von Matthäus Merian d.Ä. (1593–1650):
• Das Bild wurde bald vereinfacht kopiert:
• Wappenscheibe von Christow Froschower († 1564); vgl. das Wappen unten.
• Bruder Klaus im Gespräch mit Wilhelm Tell, der seinen Sohn bei sich hat. Niklaus von Flüe oder Bruder Klaus (1417–1487) spielte als Friedensstifter und politischer Vermittler eine Rolle beim Stanser Verkommnis 1481
• Auf dem Titelblatt der Neuauflage der Stumpff-Chronik (1606) stehen als Symbole Tell und sein Sohn sowie die drei Männer beim Rütlischwur; der Holzschnitt stammt wohl von Christoph Murer (1448–1614).
• Standesscheibe von Appenzell 1643:
• Radierung von Conrad Meyer (1618–1689):
Radierung von Conrad Meyer (1618–1689):
• Und nachmals Johann Caspar Weissenbach (Zug 1633–1678):
• Auch in diesem Geschichtsbuch für die Jugend von Johann David Köhler (1684–1755) kommt die Szene vor:
• L’Alliance & la Concorde des Suisses. B. Picart invenit et del. 1727 — David Herrliberger sculpsit Amtst[erdam]
• Johann Melchior Füssli (1677–1736); Neujahrsblatt der Bürgerbibliothek Zürich 1728:
• Bei Gottfried Eichler d. J. (1715–1770) u.a. dient Dell im Hintergrund der Personifikation der LIBERTAS (mit Pfeil inder einen Hand und Hut auf der Stange!) als Exempel (nach gelungenem Schuss):
• ExLibris von Jacob Troll (Winterthur 1758–1819), Gegner der Helvetik, Mitglied des Grossen Rats von Zürich 1803–1814; vgl. HLS
• Radierung von John Sinck aufgrund des Ölbilds von Antonio Zucchi (1726–1795)
• Auf dem Titelblatt eines Werks über die Schweiz thront die Helvetia; auf dem Podest des Throns:
• Detail von der Tür eines bemalten Bauernschranks, Ostschweiz, 1782 (Schweizerisches Landesmuseum, Zürich)
• Der französische Geschäftsträger in der Schweiz, Joseph Mengaud, versuchte 1798, die Revolution gegen das Ancien Régime mit diesem (leicht blasphemischen) Text vorzubereiten:
Vgl. > http://www.birsfaelder.li/wp/politik/12-guillaume-tell-und-die-importierte-freiheit-2/ • Alexander Trippel (1744–1793), Becherfuss für die Helvetische Gesellschaft (1782):
• Im Jugendbuch von Leonhard Meister (1741–1811), Helvetische Galerie großer Männer und Thaten für die vaterländische Jugend mit 25 Schellenbergischen Vignetten, Zürich: David Bürkli 1786; Seite 18. • Schweizerlieder von Johann Caspar Lavater [1741–1801] Neue, vollständige Auflage, besonders für Schulen, Zürich: bey David Bürkli, 1788:
• Das Siegel des Kleinen Rates der Helvetischen Republik (1798–1803) ist nach dem Vorbild des Bechers von Trippel geschaffen: • Guillaume Tell. No. I. Dessiné par Charles Abraham Chasselat (1782–1843). Gravé par Noel Jne. A Paris, chez Tessari et Co., Quai des Augustins, No. 25. (um 1810/20) • 1829 malt Georg Ludwig Vogel (Zürich 1788–1879) die Szene: • Das Blatt von Jean Frédéric Wentzel (1807–1869): Mit diesem zweiten Pfeil duchschoß ich Euch (Schiller) ist von G.L.Vogel inspiriert: • Titel des (1832 bis 1849 erscheinenden) Wochenblatts für die vier löblichen Kantone Ury, Schwytz, Unterwalden und Zug, hg. Beat Joseph Blunschi »Der freie Schweizer« (Ausschnitt; hier die Fassung aus der Ausgabe vom 14. März 1834):
Aus einer Illustrationns-Serie des ganzen Schiller-Dramas:
• Martin Disteli (1802–1844) im 7. Jahrgang des »Schweizerischen Bilderkalenders für das Jahr 1845«:
Literaturhinweise speziell hierzu: Gottfried Wälchli, Martin Disteli. Zeit – Leben – Werk 1802–1844, Zürich: Amstutz Herdeg & Co. 1943. Lucien Leitess / Irma Noseda / Bernhard Wiebel, Martin Disteli: … und fluchend steht das Volk vor seinen Bildern, Olten: Kunstmuseum 1977. Bernhard Wiebel, "erstechen – erschlagen – erschiessen". Randzeichnungen von Martin Disteli (1802–1844) zu Wilhelm Tell’s zweitem Pfeil. Eine Bildanalyse zum Titelblatt von Distelis Bilderkalender, in: Librarium, Zeitschrift der Schweizerischen Bibliophilen-Gesellschaft Nr. 2/2016, S. 115–126.
• Holzstich 1872 von Feldmann del. / Buri & Jeker sc.
• Schulwandbild Apfelschuss (1897) von Karl Jauslin (1842–1904): • Warja Lavater (1913–2007) gibt die Geschichte auf diesem Leporello in Pictogrammen wieder (Ausschnitt):
Im Mai 2022 erscheint eine Briefmarke der Schweizerischen Post CH: Literatur: Franz Heinemann, Tell-Iconographie: Wilhelm Tell und sein Apfelschuss im Lichte der bildenden Kunst eines halben Jahrtausends (15.–20. Jahrhundert) mit Berücksichtigung der Wechselwirkung der Tell-Poesie, Luzern: Doleschal / Leipzig: Avenarius [1902]. Das Lied von der Entstehung der Eidgenossenschaft / Das Urner Tellenspiel, hg. von Max Wehrli (Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Abt. 3, Chroniken und Dichtungen; Band 2, Teil 1), Aarau: Sauerländer 1952. – Abdruck von vier handschriftlichen Fassungen des Lieds und Rekonstruktionsversuch (S. 14–16). Hans Trümpy, Bemerkungen zum alten Tellenlied, in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 60 (1965) S. 113–126. Lilly Stunzi [und andere Autoren]: Tell. Werden und Wandern eines Mythos, Bern / Stuttgart: Hallwag 1973. [reich bebildert] Hans-Peter Naumann, Tell und die nordische Überlieferung. Zur Frage nach dem Archetypus vom Meisterschützen, in: Schweizerisches Archiv für Volkskunde 71 (1975), S. 108–128. Weißes Buch von Sarnen; Auszug mit Wortlaut und Übersetzung von Bruno Meyer, Sarnen 1984. Peter Utz, Die ausgehöhlte Gasse. Stationen der Wirkungsgeschichte von Schillers "Wilhelm Tell", Königstein im Taunus: Forum Academicum 1984. Jean-François Bergier, Wilhelm Tell. Realität und Mythos, München/Leipzig 1990; Neuausgabe 2012. Rosmarie Zeller, Beispiel Wilhelm Tell oder wie "Wilhelm Tell" zum schweizerischen Nationaldrama wird. In: Friedrich Schiller in Europa. Konstellationen und Erscheinungsformen einer politischen und ideologischen Rezeption im europäischen Raum vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, hg. Anne Feler u.a., Heidelberg: Winter 2014, (Beihefte zum Euphorion 76), S.103–120. Interview mit Peter von Matt > https://www.news.uzh.ch/de/articles/2012/wilhelm-tell-ist-einfach-eine-gute-geschichte.html |
||
Die GerichtsszeneDie Übersetzung von Ciceros »De officiis« (zuerst 1531) und Petrarcas Glücksbuch (zuerst 1532) mit denselben Holzschnitten des Petrarcameisters wurden mehrfach aufgelegt; das letztere in 10 Auflagen bis 1620.
Es wundert nicht, dass so ein Bild in einem einschlägigen Kontext abgekupfert (oder besser: ›abgeholzt‹) wurde; seitenverkehrt wie bei Kopien üblich, und mit kleineren Änderungen. • In der ›Carolina‹ darf das Bild nicht fehlen:
• Ein besseres Bild aus einem einzigen Druckstock in einer späteren Ausgabe – offensichtlich inspiriert am Petrarcameister (seitenverkehrt kopiert):
• Eine neuerliche Kopie erscheint dann noch 1589:
• Johannes Stumpff bringt 1547 ein daran inspiriertes Bild in seiner Chronik I,94recto zum Bauernkrieg 1525 und I,141recto zur Christenverfolgung unter Nero (!):
Beim Vergleich erkennt man auch Qualitäten des Petrarcameisters. (Danke, Romy, für die Hinweise!) • Johann Jakob Wick (1522–1588) zeichnet das Bild ab zur Illustration seines Berichts Ein Warhaffte Gschicht von einem grossen Mörder in dem 1581 Jar:
|
||
Orang-Utang
|
||
Nashorn und ElefantEs gibt eine über anderthalb Jahrtausende sich erstreckende Tradition der Vorstellung vom Nashorn-Elefanten-Kampf, die kaum der Wirklichkeit entspricht, aber munter weitererzählt wurde – auch wenn es bereits gute empirische Berichte gab. Plinius, Naturkunde (aus dem Jahr 77 n.Chr.):
Das Verhalten kennt auch Aelian (2./3. Jh.), dessen Buch »Über die Eigenheiten der Tiere« griechisch verfasst ist (1556 von Conrad Gessner ins Lateinische übersetzt):
Dürer zeichnete 1515 ein Nashorn, das König Manuel I. von Portugal geschenkt worden war --- das er selbst nie gesehen hat, sondern indem er eine Beschreibung eines Briefpartners bildnerisch umsetzt!
Der Braslienreisende André Thevet (1516-1590) berichtet in seinem Buch »Les singularitez de la France antarctique, autrement nommée Amérique, et de plusieurs terres et isles découvertes de nostre tems« aus Afrika vom Rhinoceros, ainsi appellez, pource qu’ils ont vne corne sus le nez. […] Cest animal est fort monstrueux, & est en perpetuelle guerre & inimitié auecques l’Elephant. Et pour ceste cause les Romains ont pris plaisir à faire combatre ces deux animaux pour quelque spectacle de grandeur […]. Auf der Reise von Ägypten nach Arabien hat Thevet auf einem Obelisken Figuren gesehen, die für Buchstaben stehen, aber ohne Horn, und mit anderen Gliedern als es unsere Maler darstellen [also wahrscheinich ein Nilpferd]; deshalb bringe er jetzt ein solches [europäisches] Bild. Es ist das vom Nashorn-Elefanten-Kampf. Dann folgt eine Übersetzung der Plinius-Stelle.
François Rabelais (1494–1553) kennt die Story:
Conrad Gessner (1516–1565) bringt in seinem Tierbuch (deutsche Übersetzung von Conrad Forrer: Thierbuoch/ das ist ein kurtze Bschreybung aller vierfüssigen Thieren/ so auff der Erden und in Wassern wonend/ […] Getruckt zuo Zürych bey Christoffel Froschower im Jar als man zalt 1563; fol. LXXVII verso) zwar den Plinius-Text, aber kein Bild des Nashorn-Elefanten-Kampfs. – Das Bild lässt sich indessen der Herausgeber der Neuausgabe 1669 nicht entgehen:
Sebastian Münster, »Cosmographia«, Ausgabe Basel: Seb. Henricpetri 1588 (evtl. schon früher), 5. Buch, 75. Kapitel Von dem Thier Rhinoceros = pag. mccclv (ohne Bild):
Wärend Elefant und Nashorn einander auf dem Titelbild der Brüder de Bry noch griesgrämig anschaun, werden sie auf dem Kupferstich im Buchinneren hier friedlich gezeigt:
Seltsam ist die Umkehrung des Motivs in der Fabel bei Ægidius Sadeler: Hier blufft das Rhinoceros damit, dass es den Elefanten in die Flucht schlägt oder stirbt:
Athanasius Kircher (1602–1680) kennt das Verhalten des Nashorns: Rhinoceros cum eo [sc. Elephanto] bellum gerit. (S.59) Deshalb trennt er wohl sicherheitshalber die Stallungen der beiden Tiere durch einen weiträumigen Schacht in der Arche (Tafel nach S.116):
Eberhard Werner Happel (1647–1690) verfasste seit 1683 ein Wochenblatt »Gröste Denckwürdigkeiten der Welt (Relationes Curiosae)«, das auch in 5 Bänden vorliegt. Happel weist 1685 die Physiologus-Geschichte, wonach man Elefanten fangen kann, indem man einen Baum ansägt, an den sie sich anlehnen, ihn so umstürzen, selbst umfallen und nicht mehr aufstehen können, zurück (S. 708a). Er möchte seine Erzehlung meistentheils mit Exempeln erweisen/ und mit dem Zeugnüß derer/ so rechte Augen=Zeichen [sic] gewesen sind (708b). Er beschreibt anhand von Reiseberichten verschiedene Techniken des Elefantenfangs, der Abrichtung und Dressur, ihrer Pflege, berichtet von ihrer Intelligenz, von den seltenen weissen Elefanten, von Elefanten-Kämpfen und Unfällen mit wütenden Elefanten. Im Abschnitt Der Elefanten-Feind wird gesagt: Es führet der Elefant einen continuierlichen Krieg mit dem Rhinoceros oder Nashorn/ welcher ihm mit seinem spitzigen Horn/ so er auf der Nasen führet/ gemeinigleich nach dem weichen Unterbauch trachtet/ allwo er ihn am füglichsten überwinden kan.
Michael Bernhard Valentini (1657–1729), Museum Museorum, oder Vollständige Schau-Bühne aller Materialien und Specereyen/ nebst deren natürlichen Beschreibung, […] verfasset, und mit etlich hundert sauberen Kupfferstücken unter Augen geleget. Frankfurt a.M.: Zunner 1704; [zweyte Edition 1714], S. 424 (mit dem von Dürer inspirierten Bild):
Pierre Pomet (1658–1699) interessiert sich aus drogistischen Gründen v.a. für das Nashorn, und nennt in diesem Zusammenhang auch den Kampf mit dem Elefanten:
Noch Peter Kolb wird in seinem – sonst an Empirie reichen – Werk Caput bonae spei hodiernum. Das ist: Vollständige Beschreibung des Africanischen Vorgebürges der Guten Hofnung […] von Peter Kolben, Nürnberg/ bey Peter Conrad Monath 1719 das Bild vom Nashorn-Elefanten-Kampf bringen: D. Georg. Christoph. Petri ab Hartenfels [1633–1718], ein Spezialist für Elefanten bringt die einschlägigen Texte dazu und dazu ein Bild:
Die Szene erscheint sodann im Kinderbuch von Friedruch J.Bertuch:
Und noch 1900 in einem Magazin:
Nashorn und Elefant eventuell in friedlichem Zusammenleben auf einem Titelbild 1691 angehandelt hier: |
||
Der fuß-lose Paradiesvogel
|
||
Beispiel für bewusst intendierte Übernahme eines Motivs: der Babylonische TurmZunächst der Basis-Text:
und die Vor-Bilder: Pieter Brueghel der Ältere, ca. 1563 (Kunsthistor. Museum Wien) Christoph van Sichem d.Ä.
Nun einige Anwendungen, bei denen die Konnotationen die Aussage beeinflussen: Aus dem Emblembuch von Georgette de Montenay (1540–1581):
Die Personifikation der Verwirrung zeiget einen Grundruß vom bablonischen Thurm vor mit der Auffschrift Babylonia undique ≈ überall ist Verwirrung.
Der Turm zu ... oder wie die Bank der Krise im Baufach Herr werden will.
Autofalle Innenstadt – Nichts geht mehr
Führt die turmhohe Menge der Bücher ebenfalls zur Verwirrung?
Gegner der Kernkraftwerke warnen mit dieser Überlagerung des babylon. Turms von P.Brueghel mit einem Kühlturm:
Ein grossartiges Plakat hat das Nouveau Musée Bienne zur Ausstellung Le bilinguisme n’existe pas (22.6.2019 bis 22.3.2020) gestaltet: |
||