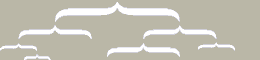
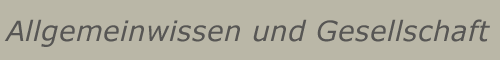
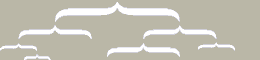 |
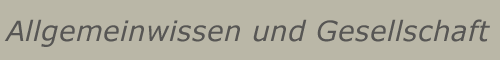 |
Gregor REISCH, »Margarita Philosophica« |
Gregor ReischGeboren ca. 1470 — 1487 an der Universität Freiburg/Br. immatrikuliert — 1489 Magister artium — 1494 an der Universität Ingolstadt — die »Margarita Philosophica « widmet er Ende 1495 dem Grafen Franz Wolfgang von Zollern — Einritt in den Kartäuserorden, wo er in Freiburg 1502 Prior wird — 1503 erster Druck der »Margarita« — seit 1509 Beichtvater von Kaiser Maximilian I. — gestorben am 9. Mai 1525. »Margarita Philosophica«Die »Margarita« ist ein systematisch geordnetes Kompendium des Grundwissens für Studenten. Es ist eine der frühen gedruckten Enzyklopädien Europas. (Vgl. die chronologische Übersicht enzyklopädischer Werke hier.) Gespiesen ist sie aus der Wissensliteratur der klassischen Antike (Aristoteles, Cicero), der Spätantike (Boethius, Cassiodor), der Kirchenväter und des Mittelalters (Thomas von Aquin, Albertus Magnus u.a.) sowie aus Spezialliteratur. Zweck ist indessen nicht einfach die Gelehrsamkeit; auf dem Titel der Ausgabe 1504 steht der Satz: Initium Sapientiae Timor Domini (Psalm 111 [Vg.], 10). Den Titel (margarita = Perle, Schatz, vgl. Matthäus-Evg. 7,6 und 13,46) hat Reisch nicht erfunden. Albrecht von Eyb (1420–1475) nannte sein Florilegium aus antiken Texten und Petrarca bereits »Margarita poetica«. (Autograph, 1459 in Italien abgeschlossen, ist erhalten; das Werk wurde zwischen 1472 und 1503 zwölfmal gedruckt.) Um das Profil der »Margarita« einzuschätzen, müsste man den Kontext zeitgenössischer Überlegungen beiziehen. Einen Eindruck der Kritik am scholastischen Wissen, am sinnlosen Unterrichtsleerlauf und am als schlecht empfundenen lat. Stil geben beispielsweise: Jakob Wimpfeling, »Stylpho« (1494), lat./dt. übersetzt und hg. von Harry C.Schnur, Stuttgart 1971 (Reclams UB 7952). Heinrich Bebel, »Comoedia de optimo studio iuvenum« (1501), lat./dt. hg. und übersetzt [und kommentiert; mit einer ausführlichen Einführung] von Wilfried Barner, Stuttgart 1982 (Reclams UB 7837). Inwieweit Reisch ›humanistische‹ Elemente in sein scholastisches Grundmuster aufgenommen hat, charakterisiert Münzel (1938), S.79f. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Ausgaben:Erstausgabe: MARGARITA PHILOSOPHICA totius Philosophiæ Rationalis / Naturalis & Moralis principia dialogice duedecim libris complectens, Freiburg/Br.: Joh. Schott 1503. Titel des (Raub-)Drucks bei Grüninger 1504: Aepitoma omnis phylosophiae. alias Margarita Phylosophica tractans de omni genere scibili. Cum additionibus: Quę in alijs non habentur. Umfang (1517er-Ausgabe): 292 Fol. = 583 Seiten im Oktav-Format. – Auflage (1517er-Ausgabe): 480 Exemplare
Die Holzschnitte werden von Auflage zu Auflage übernommen. (Mehr dazu hier unten ➜) Digitalisate:
Reprint der Ausgabe Basel 1517, mit Vorwort und Einleitung von Lutz Geldsetzer, Düsseldorf: Stern-Verlag Janssen & Co. 1973. Englische Teil-Übersetzung mit Einleitung: Sachiko Kusukawa / Andrew R. Cunningham, Natural philosophy epitomised: Books 8-11 of Gregor Reisch’s Philosophical Pearl (1503). Aldershot: Ashgate 2010. deutsche [Gesamt-]Übersetzung von Otto und Eva Schönberger: Margarita Philosophica (Basel 1517), Würzburg: Königshausen & Neumann 2016. [Diese Übersetzung ist höchst verdienstvoll; einige kleine Fehler kann man hinnehmen.] Forschungsliteratur hier unten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbau des Buchs und der TexteGroßgliederung(en) Systematisch aufgebaute Enzyklopädien, taxonomische Einteilungen des Wissens haben eine lange Tradition und waren im Mittelalter üblich; von frühen Werken seien nur erwähnt: Hrabanus Maurus (um 780 – 856), »De universo« — Alexander Neckam (115 –1217), »De naturis rerum« — Bartholomaeus Anglicus (erste Hälfte 13.Jh.), »De proprietatibus rerum« — Vinzenz von Beauvais (vor 1200 – 1264), »Speculum majus« (Drucke 1473; 1483–86) — Thomas von Cantimpré (um 1201 – um 1270), »Liber de natura rerum« Eine frühe alphabetisch organisierte Enzyklopädie ist »Suda« (Ende 10. Jh.; Druck 1581); zu Reischs Zeit: Dominicus Nanus Mirabellius, »Polyanthea« (erster Druck 1503) — Vgl. den Hinweis hier. Reisch (A) Kapitelgliederung des Texts: Die Bücher I bis VII folgen den Septem Artes Liberales.
Die Bücher VIII und IX sind der "Naturwissenschaft" gewidmet. Bücher X und XI: Die vegetative/sensitive und die Vernunft-Seele Buch XII: "Moralphilosophie" (Tugenden und Laster; Klugheit; Gerechtigkeit; Glaube – Hoffnung – Liebe) Die durch die (mit den vier Kirchenvätern auf beiden Titelblättern symbolisierte) Theologie fehlt im Buch. (B) Seltsamerweise enthält die Enzyklopädie (seit der Erstausgabe 1503) noch eine andere, schematische Gliederung (Philosophiæ partitio), nach der allerdings das Buch nicht organisiert ist: ein taxonomisches Diagramm. (Die geschweiften Klammern sind nicht typographisch, sondern nachträglich von Hand gezeichnet.)
(C) Das Titelbild der Ausgabe 1508. Hier sind die aus einem Stamm hervorsprießenden "Verzweigungen" von Septem Artes und Philosophiae realis – rationalis – naturalis undeutlich voneinander geschieden. Register Die Ausgaben enthalten seit 1503 ein alphabetisches Register (Index) am Ende des Buchs. (Dieses konnte von Auflage zu Auflage wiederverwendet werden, weil es nicht auf Seitenzahlen – die sich ja beim Neusatz verschieben konnten – verweist, sondern auf die Kapitel.) — Der »Hortus Sanitatis« Druck (1491) enthält bereits ein Register. Innerer Aufbau der Texte Die Enzyklopädie ist als Dialog zwischen Discipulus und Magister disponiert.
Der Dialog hat bei wissensvermittelnder Literatur eine lange Tradition – wir lassen die epischen Texte wie die Ilias oder das Hohelied außen vor:
Texte, die eine Unterredung mehrerer Personen mit verschiedenen Standpunkten entwerfen, zum Beispiel:
Die Dialoge bei Reisch dienen nicht nur der Textgliederung (wie im Lucidarius, wo die die Fragen des Schülers die Funktion von Zwischentiteln haben), sondern tönen mitunter recht lebendig. Wäre ein interessantes Thema... Literaturhinweise: Hannes Kästner, Mittelalterliche Lehrgespräche. Textlinguistische Analysen, Studien zur poetischen Funktion und pädagogischen Intention, (Philologische Studien und Quellen 94), Berlin: Schmidt, 1978. Carmen Cardelle de Hartmann, Lateinische Dialoge 1200–1400, (Mittellateinische Studien und Texte 37), Brill 2007. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderDiese Website ist auf eine nicht systematisch angeordnete Auswahl der Bilder in der »Margarita« focussiert. Besprochen wird nur das Ikonographische; stilistische Betrachtungen werden nicht angestellt. Reischs Werk – Figuris quoque artificiosissime effigiatis & pene innumeris totum opus illustratur – gehört zu den frühesten bebilderten Enzyklopädien (im europäischen Raum). — (Vor 1503 erschienene) Bücher wie Sebastian Brants »Narrenschiff« (1494) oder die von demsselben edierte bebilderte Vergil-Ausgabe (1502) oder Stepahn Fridolins »Schatzbehalter« (1491) oder illustrierte Bibeln kann man nicht zur illustrierten Wissens-Literatur i.e.S. zählen.
(i) In der »Margarita« lassen sich hinsichtlich der Visualisierungstechnik verschiedene Bild-Typen und deren Kombinationen ausmachen:
(ii) Die Bilder haben verschiedene Funktionen; ggf. mehrere gleichzeitig. Die Vorstellung, sie seien für Analphabeten verfertigt, so wie es Sebastian Brant im Vorwort zu seinem »Narrenschiff « 1494 schreibt: Der bildniß ich hab har gemacht/ Wer yeman der die schrifft veracht/ Oder villicht die nit künd lesen/ Der sicht jm molen [im Bild] wol syn wesen/ Vnd fyndet dar jnn/ wer er ist/ Wem er glich sy/ was jm gebrist … (Fol. aii v), greift für dieses Buch nicht.
Hier Hinweise zu Funktionen von Visualisierungen. Die Funktionsbegriffe sollten terminologisch genau bestimmt und möglichst mit einem typischen Beispiel veranschaulicht werden. Zu bedenken ist, dass andere Textsorten andere Bildfunktionen generieren: Illustration eines Epos oder Romans – Ovids Metamorphosen – ein Rechtsbuch (Sachsenspiegel) – ein Geschichtsbuch (ohne embedded reporter) – … Wie lässt sich die Funktion eines Bildes abklären? Einige Tips:
(iii) Je länger man sich in zeitgenössischen Drucken umsieht, desto wahrscheinlicher wird die Vermutung, die Bilder basierten gelegentlich auf Vorlagen. Auch wenn dies im Einzelfall nicht so ist, erhellt doch aus dem Vergleich mit einem sehr ähnlichen Bild die Eigenart desjenigen bei Reisch. Am originellsten sind einige Graphiken, die am Beginn der einzelnen Traktate stehen (➜ Typus Grammatice; ➜ Typus Locicae; Rethorica; ➜ Typus Arithmeticæ; Typus geometriae; ➜ Typus Musice; Astronomia). Vgl. hierzu Kusukawa / Cunningham, p. xxxvi –xlvi. Selbstverständlich basiert auch der Text auf Vorlagen. Beispiel: John J. Bateman hat (1983) die Abhängigkeit von Conrad Celtes’ (1459–1508) »Epitoma in vtranque Ciceronis rhetoricam …« (Druck 1492) sowie antiken und zeitgenössischen Rhetoriken für das 3.Buch der »Margarita« nachgewiesen und die Abweichungen interpretiert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die hier besprochenen Bilder(Auf den Pfeil ➜ klicken!) ➜ Frontispizien ➜ Organisation des Wissens in Gestalt eines Turms (A, S) ➜ Personifikation der Logik und Allegorie ihrer Leistungen (P, A) ➜ Die drei Dimensionen des Raums (M, I, T, K) ➜ Polygone ➜ Anatomie (M, T, O) ➜ Die drei Hirnventrikel (M) ➜ Das Auge (G) ➜ Astrologie (M, I, T) ➜ Volatilia ➜ Monstruosa Hominum Genera (M) ➜ Der Ursprung der natürlichen Dinge (N, T) ➜ Der Salamander (M) ➜ Badefreuden (M, O) ➜ Das logische Quadrat (D, T, K) ➜ Die alte und die neue Arithmetik (P, M, T, T) ➜ Der (falsch gezeichnete) Jakobsstab (M, I h) ➜ Die Erdkrümmung (M, G, O) ➜ Mappa Mundi (M, T, O) ➜ Musik (D, T) ➜ Astronomie (D, T) ➜ zu den Drucken von Grüninger in Straßburg Die Drucke der »Margarita« enthalten keine Seitenzahlen. Deshalb muss man mit Angabe von Buch / Traktat / Kapitel auf die gemeinte Stelle verweisen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Frontispizien
Ausführlich hier > ➔ http://www.enzyklopaedie.ch/fronti/frontispizien_hauptseite.html#Reisch |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisation des WissensTYPUS GRAMMATICĘ — (lat. typus = die Figur, das Bild) — Das Bild ist von unten nach oben aufsteigend zu lesen. (Noch heute sprechen wir von "Basiskenntnissen" und "Aufbau" des Studiums.)
Die »Margarita« geht indessen über die Septem Artes hinaus, ➜ das 9. bis 12. Buch. Eine ähnliche Darstellung: Der Turm der Grammatik von Heinrich Vogtherr d.Ä. auf einem Einblattdruck des Zürcher Verlags Eustachius Forschauer 1548:
Hugo von Sankt Viktor († 1141) verwendete die Gebäude-Metaphorik etwas anders in seinem »Didascalicon« VI,3: Sicut vides quod omnis aedificatio fundamento carens stabilis esse non potest, sic est etiam in doctrina. (Wie bekanntlich kein Gebäude ohne Fundament dauerhaft sein kann, so verhält es sich auch im Studium). Bei Hugo geht es darum, dass man zuerst die christlichen Wahrheiten kennen muss, bevor man das Alte Testament allegorisch auslegen kann. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personifikation der Logik und Allegorie ihrer LeistungenTYPVS LOGICĘ
Die Allegorie repräsentiert nur partiell die Inhalte des (sehr komplexen) Texts. *) Die als Bäume dargestellten Occamistæ, Scotistæ, Thomistæ, Albertistæ verweisen auf den damals virulenten Universalienstreit zwischen Nominalisten (J. Duns Scotus; W.Ockham) und Realisten. Vgl. dazu Münzel (1938) S. 42ff. Reisch selbst ist Realist. **) Hinter der Jägerin guckt in nachdenklicher Haltung ein Mann hervor; vor ihm liegt ein großer Stein. Es ist der griechische Philosoph Parmenides (angeschrieben Permenides), von dem das Mittelalter wusste, dass er die Städte und Gesellschaft der Menschen floh und sich lange Zeit auf einem Felsen aufhielt, wo er die Dialektik ersann (Hugo von Sankt Viktor; Didascalicon II, 3) – mitten unter den allegorischen Jagdgeräten, Hunden und Hasen eine reale Gestalt. Er betrachtet (in der Version bei Grüninger 1504) vier Berge: omnis / nullus / quidam / quidam non; das sind die vier Begriffe, die das sog. logische Quadrat (siehe unten) bilden.
Die Jagdszene könnte angeregt sein durch »Die mystische Jagd«, Werkstatt des Martin Schongauer um 1475/80; aus dem Zyklus der 24 Bildtafeln vom Hochaltar der Dominikanerkirche in Colmar, umweit der Wirkungsstätte von Reisch:
Thomas Murner hat das Bild in seine »Logica memorativa« [aufgrund der Druckermarke Johannes Grüninger in Straßburg zuzuweisen; im Kolophon 1509] übernommen, aber ohne einen inhaltlichen Zusammenhang herzustellen. > http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00009762/image_16 Die Wiederverwendung in diesem Traktat, in dem ähnliche Bilder verwendet werden, lässt vermuten, dass dem Bild TYPVS LOGICĘ eine mnemotechnische Funktion zugeschrieben wurde. (Hier mehr zu allegorischen Merkhilfen und hier weitere Beispiele.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die drei Dimensionen des RaumsDas Kapitel im Liber VI, Tract. I befasst sich mit dem (geometrischen) Körper und seinen Eigenschaften (De corpore et eius speciebus). Der Magister definiert einen Körper über die drei Dimensionen des Raums, wörtlich als ›eine Länge mit einer Breite und Tiefe‹ (Corpus – Est longitudo cum latitudine et profunditate), und verweist darauf, dass sich in einem Körper drei Linien in einem Punkt orthogonal schneiden. Um diese Definition in ihrer Dreidimensionalität zu veranschaulichen, werden die in der rein wörtlichen Erklärung diffus erscheinenden Eigenschaften auf den menschlichen Körper übertragen. (Das Wort corpus bezeichnet ja den abstrakten geometrischen Körper wie den menschlichen Leib.) Der Magister wählt hierzu das Gedankenspiel einen Menschen, der von Lanzen durchbohrt wird. Je nach Ein- und Austrittsstelle würde entweder die Länge (Scheitel und After), Tiefe (Brust und Rücken) oder Breite (die eine und die andere Körperseite) gemessen. Vt si lancea una per verticem capitis humani intraret et per anum exiret: metiretur longitudinem. et alia intrans per pectus et exiens in dorso metiretur profunditatem. et tertia intrans per latus unum et exiens per aliud metiretur latitudinem. (Insofern als wir sensorisch oben/unten – vorn/hinten – links/rechts empfinden, wird plausibel, dass die drei Dimensionen orthogonal zu einander stehen.)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PolygoneÜber die Vielecke. Liber VI, Tract. I, Cap. x: De pentagonis et reliquis Das Fünffeck (penthagonus) — Sechseck (hexagonus) — Siebeneck (heptagonus) — usw. — Zwölfeck (duodecagonus). Jede Polygonfigur besitzt so viele Winkel wie Seiten. Disc: Harum aliquas descriptiones [Zeichnungen!] subiungas. Der Magister kommt dieser Bitte nach: Faciam. et ecce quod petis iam depictum conspicis.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anatomie
Visualisierungstechnik: Mimetische Abbildung — Typographische Benennung der Glieder und Eingeweide, z.B.: diaphragma (Zwerchfell) — [h]epar (Leber) — stomachus (Magen) — splen (Milz) — ren (Niere). Der Text ist summarisch und hilft beim Verständis des Bilds nicht. Das Kapitel bricht ab mit der Bemerkung: Nunc quod coepimus sub brevitate percurramus. Das Bild ist falsch: Der Darm mündet hier in die Blase (vesica)! Ist es durch unhinterfragtes Buchwissen vermittelt? Von der Art der frühen anatomischen Bilder geben eine Vorstellung • links die »Anatomia« des Chirurgen Henri de Mondeville (1260–1320). Französ. Übersetzung in der Hs. Paris, Bibliothèque nationale de France, français, 2030 • rechts: Guido (Guy) de Vigevano, »Anathomia (1345) Chantilly, Bibliothèque du château 334 (Musée Condé MS 569) Nekroskopien waren im Mittelalter schon früh üblich. Hinzweisen wäre auf Pietro d’Abano (ca. 1250–1315) in Padua; Mondino de Liucci (ca. 1275–1326) in Bologna; Guy de Chauliac (ca. 1290–1368), Chirurgia magna; dessen Hss. und die frühen Drucke sind allerdings nicht illustriert. — Vgl. indessen hier:
Oder: Mondino de’ Luzzi doziert Anatomie in: Johannes de Ketham [zugeschrieben], Fasiculo di Medicina, Venedig 1495.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die HirnventrikelGrundlage ist die Lokalisationstheorie:
Reisch: Die als feinstoffliche Substanzen (SPIRITUS) vorgestellten Empfindungen z.B. GUSTUS werden zunächst zum
Das Bild erweckt den Eindruck, der Schädel sei an der interessierenden Stelle offengelegt (Graphischer Trick). Das Bild enthält ferner Verbindungslinen (I) zwischen den sensitiven Organen (Lippen, Nase, Auge, Ohr) und den Hirn; Typographsiche Mittel. Discipulus: Welche Funktionen des Sensus communis gibt es? Magister: Deren gibt es drei. Als erstes erkennt er die Reize und erkennbaren Dinge durch alle äusseren Sinne*, auch wenn die Gegenstände nicht vorhanden sind. Darum wird er communis genannt. *) gustus, visus, olfactus, auditus, tactus Zweitens unterscheidet er erstmals, ob es sich eine Uebereinstimmungen oder um Unterschiede zwischen den Objekten und dem Wahrgenommenen handelt. Wenn er anfangs einen Gegenstand durch einen Sinn erkennt, danach als zweites den Gegenstand durch einen anderen [Sinn] erfasst und zuletzt formt er [aus beiden] die Vorstellung (Tätigkeit), die virtuell die Kenntnisse über die beiden Gegenstände beinhaltet. In dieser Vorstellung legt er sowohl die Uebereinstimmungen als auch die Unterschiede derselben [der beiden Objekte] hinein. Wie z.B. weiss zugleich süss ist [Bsp. für Übereinstimmung] und ein Klang nicht kalt ist [Bsp. für Unterschiede] usw. Drittens: Er urteilt [sensus communis] über das Nichtvorhandensein (die Abwesenheit) der Gegenstände. Wie [z.B.] das, was das Sehvermögen nicht sieht und das Gehör nicht hört. So urteilt er über die Dunkelheit, die Stille und die Abwesenheit der übrigen Gegenstände. Discipulus: Ist dies jener Sinn, aus dessen Organinneren die Nerven zu den Organen der äusseren [Sinne] führen? Magister: Ja, so ist es. Daher nimmt er [sensus communis] die Gestalt von allen sichtbaren Dingen durch diese Nerven wahr und jedenfalls leicht wegen der Feuchtigkeit und der Wärme des Organs, [Geschwindigkeit der Wahrnehmung des Auges, weil die Feuchtigkeit warm ist = schnell; alles was kalt ist, ist starr und reagiert langsam], länger aber kann er [sensus communis] es nicht behalten. Darum überträgt er nach der Wahrnehmung durch die Nervenbahnen (zum Organ) der Immaginativa (Vorstellungsfähigkeit). Deren Funktion ist es, die empfangenen Erscheinungsformen (species) und Vorstellungen zu bewahren. Daher erhielt sie auch ihren Namen. Und darum wird deren Organ als trockener und kälter beschrieben (hier geht es nicht mehr so schnell, nicht warm genug). Damit aber das, was folgt, nicht im Müßiggang verbleibt (verharrt), gehen die Erscheinungsformen (species) von der Imaginativa zu der Estimativa über. Aus diesen soll diese Fähigkeit (Vermögen) die noch nicht verspürten Absichten hervorrufen. Wie ein Schaf aus den Erscheinungsformen (speciebus) des Wolfs, nämlich aus der Farbe, dem Aussehen (figura) und anderen [Sachen], die eine noch gar nie verspürte Feindschaft entwickelt und vor demselben flieht, nach Avicennas 6. Buch "De naturalis". Und dies entweder aus natürlichem Instinkt, wenn es möglicherweise die Tücke des Wolfes vorher nicht erfahren hat oder aus Erfahrung. Wie z.B. ein Esel, wenn er sich einer Grube nähert, in die er neulich gefallen ist, einen Sturz befürchtet und ausweicht. Oder aufgrund der Verbindung wie wenn wir die roten Kirschen als süss einschätzen. Discipulus: Was sind Intentionen? Magister: Sie sind Erscheinungsformen (species) der Empfindungen und demnach sind sie viel einfacher als die Erscheinungsformen der wahrnehmbaren Dinge. Und sie können wegen der Unfähigkeit (Ungeeignetheit) der Organe von den äusseren Sinnen nicht wahrgenommen werden. Im Verhältnis entsprechen sie aber dieser Fähigkeit und wenn die Vernunft diese schmückt, wie dies bei den Menschen der Fall ist, pflegen wir sie nun nicht mehr Estimativa, sondern Cogitativa oder Partikularvernunft zu nennen. Über die Memoria und ihren Ort im Gehirn handelt dann nach Ausführungen über den Traum erst Cap. 29. (Übersetzung von B. Braune-Krickau und D. Senekovic; vgl. die englische Übersetzung von Kusukawa / Cunningham p. 205) Mögliche Vor-Bilder: (1) Aus einem Albertus Magnus zugeschriebenen Werk, 1490 (vgl. W.Sudhoff):
(2) Johannes de Ketham zugeschrieben, Fasciculus Medicinae, Venedig 1491. (3) Ludovicus Pruthenus, Trilogium anime non solum religiosis verumetiam secularibus predicatoribus confessoribus contemplantibus et studentibus lumen intellectus et ardorem affectus amministans, Nürnberg: Koberger 1498 ; Cap. XXIII
(4) [Kapitelüberschrift:] Compendiosa Capitis phisici Declaratio : principalium humani corporis membrorum figuras liquido ostendens.
(5) Aus: Magnus Hundt, Anthropologium de hominis dignitate, natura et proprietatibus, Leipzig: Wolfgang Stöckel, 1501. (vgl. K.Sudhoff) Literaturhinweise: Karl Sudhoff, Tradition und Naturbeobachtung in den Illustrationen medizinischer Handschriften und Frühdrucke, vornehmlich des 15. Jahrs. Studien zur Geschichte der Medizin, Heft 1, Leipzig: J.A. Barth 1908. Walther Sudhoff, Die Lehre von den Hirnventrikeln in textlicher und graphischer Tradition des Altertums und Mittelalters, Leipzig 1913. (Download via jstor.org) Edwin Clarke / Kenneth Dewhurst, Die Funktionen des Gehirns: Lokalisationstheorien von der Antike bis zur Gegenwart, München: Moos, 1973 (157 Seiten; 158 Abb.) Anhang: Die Theorie und das Bild haben eine lange Tradition; hier nur einige Hinweise: ••• Der Dominikaner Johannes Host = Johannes Romberch de Kyrspe verfasste eine "Sammlung (Congestorium von lat. congero: zusammentragen) zur Gedächtniskunst" (Mnemotechnik), in der er zunächst darlegt, wo das Gedächtnis physisch lokalisiert ist:
••• Robert Fludd, Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris […] historia, tomus II (1619), tractatus I, sectio I, liber X, De triplici animae in corpore visione ••• Korrespondenzen des äußeren und innerlichen Menschen in einem geistlichen Text. Ausgangspunkt das Zitat von Bernhard von Clairvaux: Gleich wie der Aussere Mensch durch das Angesicht erkennet wird, also wird der innerliche Mensch durch den Willen angezeiget.
••• Eine Lokalisationstheorie hat Franz Joseph Gall (1758–1828) in seiner ›Schädellehre‹ entworfen; mehr dazu hier ••• Fritz Kahn (Das Leben des Menschen, 1929) visualisiert Sehen – Denken – Sich-Erinnern in Gehirn-Regionen, als hätte er Gregor Reisch gekannt:
••• Wilder G. Penfield (1891–1976) konnte corticale Regionen im Gehirn mittels (seriöser) Experimente in Relation setzen zu den sensorischen und motorischen Fähigkeiten der davon innervierten Körperteile. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das AugeEinen kleinen Eindruck der mittelalterlichen Lehre vom Auge und seinen Häutchen (septem tunicae aut pelliculae sive telae) vermag der Passus bei Konrad von Megenberg (Mitte 14.Jh.) zu geben (Buch de Natur I, Kap.5): Daz aug ist gesetzt in siben röcke, daz sint siben häutel, dâ mit ist die cristallisch fäucht verhüllt, dar an des gesichtes kraft ligt. Reisch: Das Auge besteht aus vier Häuten und drei Flüssigkeiten.
Im handschriftlich verbreiteten, der Optik gewidmeten Traktat »Perspectiva communis« von Johannes Peckam († 1292) befinden sich bereits naturnahe Illustrationen. Vgl. Bednarski, Fig. 10: (Die anatomischen Zeichungen fehlen in den Drucken 1482, 1504.) — Hier ein Bild aus einem späteren Druck:
Literaturhinweise: Adam Bednarski, Die anatomischen Augenbilder in den Handschriften des Roger Bacon, Johann Peckham und Witelo, in: Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin Bd. 24, Heft 1 (1931), pp. 60–78. Gudrun Schleusener-Eichholz, Das Auge im Mittelalter, (MMS 35), München 1976; Band 1, S. 34–44. David Charles Lindberg, Theories of Vision from Al-kindi to Kepler, University of Chicago Press 1976 [nichts Einschlägiges zu Reisch]. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstrologieVon der Astrologie (im heutigen Sinne) hält Reisch wenig. Zum Thema der Natur der Sternzeichen (signorum natura) bringt er (Liber VII, Tract. 2, Cap. 1) die Zuordnung der Sternzeichen zu ihren elementaren Eigenschaften, zu den Temperamenten und den Bezug zu Körperteilen. (Diese Bezüge werden in sprachlicher Variation vage ausgedrückt, z.B. caput sibi vendicans; colla respicit; obtinet pectus; <h>epar regit; …) Reischs Text hier als Tabelle dargestellt:
Dieser Text wird graphisch so umgesetzt:
Visualisierungstechnik: Mimetische Abbildung des Körpers — Icons (Pictogramme der Sternzeichen) — Typographische Mittel (Schrift; Verweispfeile). Es werden nur Teile aus dem Text übernommen. Funktion: Die Zusammenhänge zwischen den Konzepten (Sternbild – elementare Eigenschaften und Temperamente – Gliedmaßen) visualisieren. Die Ausgabe Straßburg: Grüninger 1504 verwendet ein anderes Bild:
Je nachdem, in welchem Tierkreiszeichen der Mond stand, war eine Körperregion mehr oder weniger zum Aderlass geeignet. Entsprechend wurden die zwölf Phasen des Tierkreises einzelnen Gliedern und Organen des menschlichen Körpers zugeordnet und festgelegt, an welchen Stellen und in welchem Zeitraum Blut entnommen werden konnte, ohne dabei den Patienten zu gefährden. Das Bild hat somit die Funktion einer Betriebsanleitung für den Arzt, also am ehesten h. Ein früher Druck einer solchen Darstellung findet sich im »Fasciculus Medicinae«, Venedig 1491. Die Bilder gleichen sich oberflächlich, haben aber eine andere Funktion! — Dasjenige von 1504 passt nicht zum Text von Reisch. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VolatiliaThema des ersten Kapitels über die fliegenden Tiere ist die Fortpflanzung der Vögel, insbesondere das Entstehen des Eis und die Herausbildung des Kükens im Ei. Beiläufig wird erwähnt, wieviel Mal im Jahr Raubvögel / Tauben / Hühner Eier legen. Im dritten Kapitel (xxxi) wird der verschiedene Bau der Organe bei Raubvögeln und Wasservögeln erwähnt. Aber eine Übersicht über die Gattungen wird nicht gegeben: Sunt enim (ut ait Ambrosius [Hexaemeron]) avium genera diversa: quae memoria aut cognitione comprehendere quis possit? — Funktion: T
Solche Wimmelbilder kommen vor in Frühdrucken zur Naturkunde, hier beispielsweise: Konrad von Megenberg, Buch der Natur, Augsburg: Johann Bämler, 1481.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monstruosa Hominum GeneraIn der Ausgabe Straßburg 1504 und dann Basel 1508 erscheint in Liber VIII, Cap. xix De monstruosis & miraculosis effectibus a quibus fieri possint ein Bild mit monstruösen Menschen (dasselbe Bild in Liber IX, Cap xl: De gemellis, monstris et abortivis fetibus). Der Text nennt Monstren, die nur ein Auge mitten auf der Stirn haben, solche bei den die Füße verkehrt stehen, solche, die Augen an den Schultern haben, und Hundsköpfige. Zitiert wird Augustinus, Civitas dei XVI,8.
Die Darstellungen muss man als mimetisch bezeichnen, auch wenn sie nicht natürlicher Anschauung entommen sind. — Funktion? "Alternative Fakten" (ein Begriff, den Präsident Trumps kongeniale Kommunikations-Chefin Kellyanne Conway prägte) glauben wir eher, wenn sie als Bild präsentiert werden, als wenn sie in einem Text erwähnt werden. Vielleicht ist die Funktion eine Beglaubigungsstrategie. Einige Gestalten ähneln (links) denjenigen in der Schedelschen Weltchronik (1493) Fol. XII recto und (rechts) einem Bild in Esopi appologi sive mythologi: cum quibusdam carminum et fabularum additionibus Sebastiani Brant. Basel: Jacob Wolff von Pfortzheim 1501.
Eine spätere Ausgabe der »Margarita« geht phanstasievoll mit dem Bild um:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Ursprung der natürlichen Dinge
Das zum Titel (origo = der Ursprung) passende Bild ist von einer Bibelillustration inspiriert: Im Paradies erschafft Gottvater das Weib aus der Rippe, die er Adam entnommen hat. (Genesis 2,21: Immisit ergo Dominus Deus soporem in Adam: cumque obdormisset, tulit unam de costis ejus, et replevit carnem pro ea.)
Visualisierungstechnik: Narrativ. — Weitere biblisch inspirierte Bilder in der »Margarita«: Hölle und Fegefeuer — das Paradies. Solche T-Bilder haben eine Tradition in den handschriftlichen Enzyklopädien. Dort gibt es figurierte Initialen, die als Dispositionsmerkmal oder Findehilfe für die Leser dienen. (Vgl. den unten zitierten Aufsatz von Ch. Meier-Staubach, FrühMiSt 31). Beispiele: Aus Isidor von Sevilla, Beginn der Kapitel zu Mundus und Medicina:
Aus Bartholomaeus Anglicus († 1272). Livre des proprietés des choses de Bathélemy l'Anglais , traduit du latin par Jean Corbichon; Beginn des Kapitels des maladies:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der SalamanderDer Salamander entsteht aus dem Wasser, kann aber auch im Feuer leben (Augustin, Civitas Dei 21,4). Plinius sage von ihm (nat. hist. X, lxxxvi, 188), das Tier habe die Gestalt einer Eidechse und lösche Feuer, das es berührt, wie Eis:
Das Tierlein hat der Illustrator aber in vivo nicht gesehen; es ist ausgebüxt (‘AWOL’) aus dem Buch von Bernhard von Breydenbach (1440–1497):
Mehr zu den Wanderungen des Salamanders hier. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BadefreudenMan würde glauben, dass die Illustratoren in Freiburg die warmen Quellen und Bäder aus eigener Anschauung kannten und deshalb solche mimetische Bilder zeichneten, wie dasjenige zu Liber IX, Cap. xv: de fontium:
Die Anregung dürfte wohl von diesem Bild kommen, man beachte die Zweiteilung des Wasserbeckens (für Damen und Herren?) und das Schankzeichen am Wirtshaus: "es ist ausg’steckt", d.h. man bekommt heurigen Wein...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das logische QuadratDas logische Quadrat dient der Veranschaulichung elementarer logischer Beziehungen von Aussagen mit jeweils demselben Subjekt und Prädikat. Der Ursprung dieser Aussagen findet sich in Aristoteles’ Werk »De Interpretatione« 6–7, welche im zweiten Jahrhundert n. Chr. von Apuleius von Madaura vervollständigt und graphisch in die quadrata formula, das logische Quadrat, umgesetzt wurden. Die bis heute gebräuchliche Terminologie der einzelnen Bestandteile geht auf Boethius und dessen Aristoteles-Kommentare zurück. Die 4 verschiedenen logischen Beziehungen (konträr – kontradiktorisch – subaltern – subkonträr) zwischen den 4 verschiedenen Urteilstypen (allgemein bejahend – allgemein verneinend – partikulär bejahend – partikulär verneinend) lassen sich tabellarisch so darstellen:
Die Tabelle (oder gar ein solcher Text) ist schwer lesbar. Die Beziehungen werden seit der von Michael Psellos im 11. Jh. ersonnenen Graphik kompakt und einprägsam so visualisiert:
Die Kreise auf der linken Seite enthalten die bejahenden, die auf der rechten die verneinenden Aussagen. Sätze, welche kontradiktorisch sind, d.h. sich gegenseitig ausschliessen, stehen sich diagonal gegenüber. Aussagen mit entgegengesetzten Prädikaten sind zueinander horizontal angeordnet. Die Relationen zwischen diesen wird als konträr (allgemeine Aussagen) bzw. subkonträr (partikuläre Aussagen) bezeichnet. Die partikulären Aussagen sind jeweils logisch in den allgemeinen enthalten und werden daher als subaltern zu diesen bezeichnet. Die Darstellung in der »Margarita« verwendet als Subjekt homo und als Prädikat est animal (›Lebewesen‹). Die beiden oberen Kreise enthalten die allgemeinen (omnis / nullus bos est animal – ›jeder / kein Mensch ist ein Lebewesen‹), die beiden unteren die partikulären Aussagen (quidam homo est est animal / quidam homo est non est animal – ›ein gewisser Mensch ist [nicht] ein Lebewesen‹). — Das Beispiel ist nicht sehr klug gewählt, statt ›Lebewesen‹ wäre z.B. ›blond‹ besser; denn es gibt wirklich Menschen, die nicht blond sind... Visualisierungsmittel: Diagramm – Typographie Literaturhinweise: Moderne Darstellung > http://en.wikipedia.org/wiki/Square_of_opposition Carl von Prantl, Geschichte der Logik im Abendlande, Leipzig: Hirzel 1855. H. Schepers, Artikel ›Quadrat, logisches‹ in: Historisches Wörterbuch der Philosophie; Band 7 (1989), Sp. 1733–1736. Terence Parsons, ›The Traditional Square of Opposition‹, in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.) > http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/square/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die alte und die neue ArithmetikTYPVS ARITHMETICAE Das Bild zeigt den Vorzug der neuen Rechenmethode (mit Ziffern) vor der alten (mit dem Abakus) durch eine Gegenüberstellung von zwei historischen Figuren aus verschiedenen Zeiten (Tituli BOETIVS und PYTAGORAS).
Visualisierungsmittel: Personifikation — pseudo-mimetische Portraits – echt-mimetische technische Werkzeuge (Abakus, Ziffern-Tafel) — Typopgraphische Verdeutlichung Die fälschlich Boethius zugeschriebene, heute als "Geometrie II" bezeichnete Schrift »scheint […] das früheste lateinische Werk zu sein, in dem arabische Ziffern dargestellt sind.« Vgl. Menso Folkerts, "Boethius" Geometrie II. Ein mathematisches Lehrbuch des Mittelalters; Wiesbaden: Steiner 1970. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der JakobsstabMit dem Jakobsstab (baculus iacob) lässt sich der Abstandswinkel zwischen zwei Punkten messen. Man hält das Instrument ans Auge und visiert über die am Querstab zuäußerst angebrachten Nägel. Den Querstab verschiebt man, bis Auge – Nägel – anvisiertes Objekt auf einer Geraden liegen. Auf dem Längsstab ist eine Skala angebracht, die dort, wo der Querstab zu stehen kommt, den Winkel angibt. Misst man den Winkel von zwei Standorten aus, so lässt sich mit dem Strahlensatz in der Geometrie beispielsweise die Höhe eines Gebäudes oder Bergs bestimmen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die ErdkrümmungIn Liber VII, Tract. i wird die Gestalt der Erde abgehandelt: De figuratione et natura terrę. Die Kugelgestalt werde gut einsichtig durch das Phänomen, dass der Seemann ein entferntes Gebilde (hier das Fundament eines Turms am Ufer: figura in litore) nicht sieht, wenn er über die Reling schaut (oculus inferior), hingegen vom Mastkorb (oculus superior) aus sieht.
Die Anregung stammt wohl aus Johannes de Sacrobosco ( um 1195 bis 1256), »Tractatus de Sphaera«:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mappa MundiIn der Erstausgabe 1503 gibt es eine Weltkarte im Stil des Ptolemaeus, ähnlich wie sie 1493 viel einfacher in der Schedelschen Weltchronik (Fol. XIIv/XIIIr) erschien. (300 x 411 mm)
Für die Ausgabe Straßburg: Grüniger 1513 soll Reischs Kommilitone Martin Waldseemüller († 1520) eine modernere Weltkarte beigesteuert haben: Typus universalis terrae, iuxta modernorum distinctionem and extensionem per regna et provincias:
Hier ist der neu entdeckte Kontinent bereits skizziert. Man beachte für Südamerika: Paria seu prisilia
Für die Ausgabe Straßburg: Grüniger 1515 gibt es ein Update, dazu eine schiftliche Noua terrę descriptio:
Geographische Texte stehen in Liber VII, Tract. i, Cap. 44–52, z.Bsp.: De partibus terrae habitabilibus iuxta divisionem eius in zonas quascumque … Et paradisus qualis aut in qua parte terrae sit (Cap. 45); De divisione terrae habitabilis in Europam, Asiam et Africam (Cap.49 sqq.) In diesen Texten wird (seit 1503) auf die Landkarte verwiesen:
Literaturhinweis: https://www.press.uchicago.edu/books/HOC/index.html hier der Artikel Vol. 3 / Part 1 / Chapter 9: Patrick Gautier Dalché, The Reception of Ptolemy’s Geography (End of the Fourteenth to Beginning of the Sixteenth Century) Vgl. auch hier das Kapitel zur Geographie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MusikIn Liber V, Tract. ii gibt es Diagramme, die ohne Kennntisse der historischen Musikwissenschaft nicht zu deuten sind:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstronomieIn Liber VII, Tract. i erscheinen seit der Erstausgabe mehrere Diagramme, die ohne genaue Textkenntnisse nicht zu deuten sind. Ein Beispiel:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zu den Drucken von Grüninger in StaßburgDer Drucker/Verleger Johannes Grüninger (ca. 1455–1532) hatte Erfolg mit bebilderten Büchern: Boethius (1501); Vergils Aeneis (1502), Murner, Sebastian Brant. Bereits ein Jahr nach der Erstausgabe der »Margarita« druckt er auch dieses Buch – ein©opyright gab es damals noch nicht, aber offensichtlich einen Markt für Bücher enzyklopädischen Inhalts. Parallel zu den "rechtmäßigen" Ausgaben erscheinen bis 1515 weitere "Raubdrucke". Den Text kann er einfach wieder setzen lassen; die Bilder lässt er neu als Holzschnitte verfertigen. Einige sind nicht präzis, andere verbessert er; zudem fügt er neue Bilder ein. Der Verleger Schott reagiert sauer und warnt seine Käufer vor dem Nachdruck, vgl. hier. Erstes Beispiel: Das Titelblatt zum 8.Buch über den Ursprung der natürlichen Dinge, wo Schott und dann Furter in allen Ausgaben bis 1517 das biblische Bild der Erschaffung Evas eingefügt hatten (vgl. hier oben), braucht Grüninger nicht kopieren zu lassen, sondern er greift auf ein Buch aus der eigenen Werkstatt zurück:
Der rechte Teil des Bilds erschien 1501 hier:
Zweites Beispiel: In allen Ausgaben von Schott und dann Furter erscheint als Vorspann zu Liber V, Tract. i: Musica speculativa (Musiktheorie) dieses Bild:
Grüninger lässt das Bild 1504 neu zeichnen und verbessern:
Die wägende Pythagoras und die vier pythagoreischen Hämmer mit sampt jhren proportion werden 1545 so abgebildet:
Literaturhinweise zu Pythagoras und Tubal (mit Hinweisen zu und Zitaten aus Quellen): Barbara Münxelhaus, Pythagoras musicus. Zur Rezeption der pythagoreischen Musiktheorie als quadrivialer Wissenschaft im lateinischen Mittelalter, Bonn / Bad Godesberg: Verlag für systemat. Musikwissenschaft 1976 (Orpheus-Schriftenreihe zu Grundfragen der Musik Band 19); S. 36–55. Gene H. Anderson, Pythagoras and the Origin of Music Theory, in: Indiana Theory Review, Vol. 6, No. 3 (1983), pp. 35–61. > https://www.jstor.org/stable/24045969 Manfred Hermann Schmid, Die Darstellung der Musica im spätmittelalterlichen Bildprogramm der Margarita Philosophica von Gregor Reisch 1503, in: Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft 12 (1994), S. 247–261. Kees Verduin (Universiteit Leiden; 2003) > https://www.leidenuniv.nl/fsw/verduin/ghio/sourchro.htm https://de.wikipedia.org/wiki/Pythagoras_in_der_Schmiede Leider wird das Bild nicht behandelt in der vorzüglichen Studie von Thea Vignau-Wilberg, O Musica du edle Kunst / Music for a while. Musik und Tanz im 16. Jahrhundert / Music and dance in 16th-century prints. München: Staatliche Graphische Sammlung 1999. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhang: Divisio OperisAbriss nach dem typograph. neu gesetzten Inhaltsverzeichnis zur Ausgabe 1517) im Reprint von Lutz Geldsetzer 1973, S. XIV – XLIV (lat. ) und O.u.E.Schönberger (dt. Übersetzung 2016), S. IX – XVIII Liber I: De rudimentis grammaticesTractatus I: De notitia partium orationis (35 Kap.) Liber II: De principiis logicesTractatus I: De praedicabilibus (9 Kap.) Liber III: De rhetoricaTractatus I: De partibus orationis rhetoricae (23 Kap.) Liber IV: De quadrivii rudimentisTractatus I: De quadrivii laudibus et divisione (37
Kap.) Liber V: De principiis musicaeTractatus I: De musicae laudibus et utilitate (19 Kap.) Liber VI: De geometria speculativaTractatus I: De elementis geometriae (22 Kap.) Liber VII: De principiis astronomiaeTractatus I: De enumeratione et ordine dicendorum (52
Kap.) Liber VIII: De principiis rerum naturalium (41 Kap.)Ob es eine Urmaterie gibt – De rerum principiis et origine, si materia prima fuerit, de generibus
causarum (Kap. 6–15), de casu et fortuna (Kap. 16–18) – ab Kap. 19: de monstruosis
effectibus – Kap.23ff: de movente immobili – Kap. 29ff: innere und von außen bewirkte Bewegung – Kap. 36ff.
Zeit, Ort. Liber IX: De origine rerum naturalium (42 Kap.)Elementenlehre, Kap. 6ff: Mixta der ersten und zweiten Zusammensetzung:
Regen, Hagel, Tau, Winde, Gewitter, Regenbogen, Kometen, Kap. 24ff: dritte
Zusammensetzung: Metalle – 26f: Pflanzen, 28ff. Tiere, 37ff.
Fortpflanzung der Tiere – Fortpflanzung des Menschen, Kap. 42: sechs
Lebensalter Liber X: De anima et potentiis eiusdemTractatus I: De potentiis animae vegetativae (5 Kap.) Liber XI: De natura, origine ac immortalitate animae intellectivae(49 Kap., in 8 campus gegliedert) Liber XII: De principiis philosophiae moralis (56 Kap.)Dreiteilung (ethica, oeconomia, monastica); quid virtus, quomodo sit medium; Kap.4–6: de passionibus: Kap. 8ff. Tugenden aufgeteilt in intellectuales (prudentia), morales (zwölf, vier Kardinaltugenden, worunter wieder prudentia, v.a. iustitia behandelt), Einschub Kap. 26–48: de religione et vitiis oppositis (nicht das 7er-Schema, Sammelsurium), und theologicae (fides, spes, charitas Kap. 49ff.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ForschungsliteraturKarl Hartfelder, Der Karthäuserprior Gregor Reisch, Verfasser der Margarita philosophica. In: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, Band 44 / NF 5 (1890), S. 170–200. Robert Ritter von Srbik, Die Margarita philosophica des Gregor Reisch, in: Denkschriften der Akademie der Wissenschaften in Wien, Math.-nat.-wiss. Klasse 104 (Wien 1941), S. 85–205. Gustav Münzel, Der Kartäuserprior Gregor Reisch und die Margarita philosophica, in: Zeitschrift des Freiburger Geschichtsvereins 48 (1938), S. 1–87. Udo Becker, Die erste Enzyklopaedie aus Freiburg um 1495. Die Bilder der Margarita Philosophica des Gregorius Reisch, Freiburg: Herder 1970. John J. Bateman, The Art of Rhetoric in Gregor Reisch's »Margarita Philosophica« and Conrad Celtes’ »Epitome of the Two Rhetorics of Cicero«, in: Illinois Classical Studies 8, no. 1 (1983): pp. 137–514. Lucia Andreini, Gregor Reisch e la sua Margarita Philosophica, Salzburg 1997 (Analecta Cartusiana 138). [Noch nicht eingesehen] Frank Büttner, Die Illustrationen der Margarita Philosophica des Gregor Reisch. In: Frank Büttner / Markus Friedrich / Helmut Zedelmaier (Hgg.): Sammeln – Ordnen – Veranschaulichen. Zur Wissenskompilatorik in der Frühen Neuzeit. Münster 2003, S. 269–300. Gilbert Heß, "Reisch, Gregor" in: Neue Deutsche Biographie 21 (2003), S. 384–386. > https://www.deutsche-biographie.de/pnd118744364.html#ndbcontent Steffen Siegel: Architektur des Wissens. Die figurative Ordnung der artes in Gregor Reischs »Margarita Philosophica«, in: Frank Büttner / Gabriele Wimböck (Hgg.): Das Bild als Autorität. Die normierende Kraft des Bildes, Münster: LIT 2004, S. 343ff. Christoph Fasbender / Franz Josef Worstbrock, Artikel "Reisch, Gregor" in: Verfasserlexikon – Deutscher Humanismus 1480-1520, Band 2, De Gruyter 2013. (= Die neueste und sorgfältigste Studie) Ilona Pichler, Margarita philosophica: Der Makel der Lüge, Universität Salzburg 2015 (befasst sich mit der Frage der Raubdrucke) Sylvain Excoffon / Coralie Zermatten (Hgg.): Sammeln, kopieren, verbreiten. Zur Buchkultur der Kartäuser gestern und heute (= Analecta Cartusiana; 337), Saint-Etienne: CERCOR 2018, 662 S.
Nicht direkt zu Reisch, hingegen für das Thema der Illustration von mittelalterlicher Wissensliteratur wichtig: Christel Meier, Illustration und Textcorpus. Zu kommunikations- und ordnungsfunktionalen Aspekten der Bilder in den mittelalterlichen Enzyklopädiehandschriften, in: Frühmittelalterliche Studien, Band 31 (1997), S. 1–31 und 28 Bildtafeln. Christel Meier, Bilder der Wissenschaft. Die Illustration des ›Speculum maius‹ von Vinzenz von Beauvais im enzyklopädischen Kontext, in: Frühmittelalterliche Studien, Band 33 (1999), S. 252–286 und 25 Bildtafeln. Jörg Jochen Berns, Bildenzyklopädistik 1550–1650, in: Martin Schierbaum (Hg.), Enzyklopädistik 1550–1650. Typen und Transformationen von Wissensspeichern und Medialisierungen des Wissens (Reihe: Pluralisierung & Autorität, hg. vom Sonderforschungsbereich 573 der LMU München, Band 18), Münster/Westf.: LIT-Verlag 2009, S. 41–78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zusammengestellt von Paul Michel für den Es gilt, was der Magister einmal sagt: plurima praeterire necesse est; non enim praesentis disceptacionis est omnia limate excoquere. (Man muss viele Dinge übergehen; es ist für unsere derzeitige Erörterung nicht sachdienlich, alles präzis auszusinnen.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||