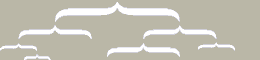
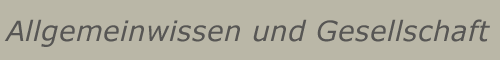
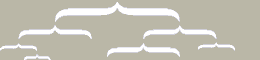 |
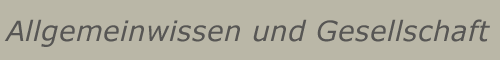 |
Verstehenshilfen |
Verstehens-Hilfen — ÜbersichtEin gutes Bild ist an sich eine Verstehenshilfe: Ein Diagramm fördert das Verständnis von statistischen Daten; eine mimetische Abbildung fördert das Verständnis des abgebildeten Objekts oder eines gedanklich imaginierten Typs usw. Es gibt darüber hinaus auch graphische Elemente, die dem Betrachter helfen, sich in der Visualisierung zurechtzufinden. Terminologie: Man sagt, dass solche Elemente im Verhältnis zum primären Bild auf einer Meta-Ebene stehen. (Zum Begriff meta- vgl. > https://de.wikipedia.org/wiki/Metakommunikation) ⬇ Bildlegenden ⬇ Beigabe eines charakterisierenden Attributs ⬇ Angabe des Maßstabs ⬇ Linien, die Zusammenhänge herstellen ⬇ Pfeile, die ein Bildelement hervorheben ⬇ Linienraster ⬇ Freistellen ⬇ Blickführung in Schritten ⬇ Details einblenden ⬇ Einfärbung ⬇ Stilisierung ⬇ Zoom |
||
Bildlegenden (Captions)Die verbalen Bezeichnungen kann man streng genommen nicht als Hilfen bezeichnen; sie gehören zum Bild-Inhalt. Die Beispiele hier sollen zeigen, mit welchen Hilfs-Mitteln die Legende (engl. caption) auf zu erklärenden Bildteil verweisen kann: • Linien führen von den Körperteilen zu den Namen der Krankheiten (z.B. 46 Mal del dosso):
• Die Bildlegende wird in einer Transparentfolie über die Visualisierung gelegt, damit diese nicht durch Beschriftung verunziert wird:
Vergleiche ferner das ausführliche Kapitel |
||
Charakterisierendes AttributAbgebildet sind hier um ihren Vater Apollo (mit Lorbeerkranz und Harfe) herum die neun Musen – die Göttinnen der schönen Künste und Wissenschaften des Alterthums. Aber who is who? Thalia [rechts außen] wird dargestellt mit einer komischen Maske und einem Jocusstab – Terpsichore rührt als Göttin der Tanzkunst die siebensaitige Leier – Urania trägt eine Kugel (die steht für den Sternenhimmel) und einen Griffel – Klio als Muse der Geschichte hält eine halbgeöffnete Pergamentrolle – usw.
Auf dem Bild hier sind andere Attribute (lauter Musikinstrumente), aber dafür die Namen angegeben:
Otto Neurath (1882–1945) hat die Balkengraphiken der Statistiken früh schon mit Pictogrammen versehen.
|
||
Angabe des MaßstabsDamit man das maßstäblich veränderte Objekt von der Graphik wieder auf die richtige Größe zurückführen kann, wird das Maß der Vergrößerung / Verkleinerung angegeben. Dazu gibt es verschiedene Techniken:
|
||
Linien, die Zusammenhänge herstellenEs geht hier nicht um Linien, die logische Zusammenhänge des Objekts thematisieren, wie z.Bsp. Lage eines Dinges im Aufriss; Bewegungsablauf; Einwirkung eines Objekts auf ein anderes; Abhängigkeit; usw. – Vgl. hierzu das ausführliche Kapitel zu den Linien.
Johannes Saubert der Ältere (1592–1646) sieht das Gegenteil ganz ähnlich: Der Heuchler (Hypocrita, Maulchrist) betet zwar in der Kirche mit dem Mund, sein Herz indessen wendet sich irdischen Schätzen zu: Geldkästlein, Kuchen, Bett, Pferdestall.
|
||
Pfeile, die ein Bildelement hervorhebenUm darauf hinzuweisen, was im Focus des Interesses steht, fügt der Graphiker einen deiktischen (hinweisenden) Pfeil ein:
|
||
Linienraster• Zur Auffindung von Orten auf der Karte wird diese mit einem Gradnetz (frz. grille de repérage) versehen. Auch Sterne und Kon-Stellationen können am Himmel so verortet werden:
|
||
Freistellen›Freistellen‹ (engl. ›cropping‹) heisst die Befreiung eines Motivs von einem störenden Hintergrund / Umfeld; damit soll sichergestellt werden, dass der Betrachter von solchem Beiwerk nicht abgelenkt wird. Die Technik wird genau beschrieben in: Nikolaus Karpf (Hg.) Angewandte Fotografie, München 1960, S. 98, Legende zu Abb. 145/146. • Bei der Dynamomaschine ist die Umgebung mit komplizierter photographischer Technik optisch abgeschwächt, damit das interessierende technische Gerät heraussticht.
• In der Bedienungsanleitung werden diejenigen Bauteile optisch hervorgehoben, die man nacheinander in die Hand nehmen muss:
• Aus Lavaters »Physiognomik« stammen wohl diese Stirnen; allein sie interessieren hier, deshalb sind die andern Gesichtsteile weggelassen:
|
||
Blickführung in SchrittenZum bessern Verständnis dessen, wie eine Gasturbine funktioniert, wird Teilbild um Teilbild gezeigt: wie die Luft komprimiert wird, dann der Brennstoff zugeführt wird, sich das entzündete Gemisch im Verbrennungsraum ausbreitet und dann die Turbine treibt (die ihrerseits den Kompressor antreibt). – Es handelt sich nicht um einen Trickfilm, der Einzelphasen beschreibt (vgl. Prozessdiagramme A2; Beispiel des Strickens), sondern nur um eine Blickführung des Betrachters.
|
||
Details einblendenWenn Details eines Objekts nicht gut erkennbar sind, werden sie separat vergrößert dargestellt und mit einem Verweiszeichen versehen:
|
||
EinfärbungBei Bildern mit vielen ähnlichen Elementen dient die Farbgebung der optischen Orientierung. • Als "Farbe" kann allein schon schwarz dienen:
• Die ägyptische Schrift besteht bekanntlich aus pictogrammartigen Bildern. Wenn ein Schriftzeichen in einem Bild oder auf einer Skulptur verwendet wird oder wenn dieses Bild teilweise nach dem Schriftzeichen gestaltet ist, ist dies für den Nichtfachmann nicht einfach zu erkennen. Richard H. Wilkinson hat in seinem Buch die Schriftzeichen deshalb farbig hervorgehoben. Hier wird gezeigt, wo auf der Skulptur auf einem kleinen vergoldeten Schrein aus dem Grab von Tut-anch-Amun das Schriftzeichen Gardiner G48 = sesh (Nest) zu finden ist:
• Hier werden die Bewegungen des linken und des rechten Beins durch verschiedene Einfärbung verdeutlicht:
• Um die Komplexität der Partitur im vierten Satz von Mozarts Sinfonie KV 551 (genannt »Jupiter-Sinfonie«) sichtbar zu machen, greift der Interpret zum Mittel der Einfärbung:
• Entsprechend dem biologischen Gesetz der Homologie liegt derselbe Bauplan der fünfstrahligen Extremität beim Pferdefuß wie beim Fledermausflügel in spezifischen Abwandlungen vor. — Der Vergleich einer schwarz/weißen (bei Haeckel) mit einer farbigen Abbildung (im modernen Biologielehrbuch) zeigt die hilfreiche Technik der Einfärbung. Die homologen Knochen sind 1911 mit denselben kleinen Buchstaben bezeichnet und 2002 gleich gefärbt:
• Im Diagramm (ein sog. ›Manhattan Graph‹) erkennt man durch die Einfärbung leichter, welche Balken zusammengehören:
|
||
Stilisierungen• Landkarten mit spezieller Funktion stilisieren die Erdoberfläche stärker auf das Interessierende hin. Hier eine Karte für ein Kursbuch (oben) im Vergleich mit der Darstellung der annähernd wirklichen Bahnlinien (unten):
• Mittels Stilisierung wird auch eine bessere Vergleichbarkeit ähnlicher Strukturen erreicht:
|
||
ZoomRäumlich Bei der Betrachtung der detaillierten Landkarte der 51 km langen Insel Ambon möchte man wissen, wo dieses Eiland im Feld der vielen indonesischen Inseln zwischen Sumatra – Borneo – Celebes (heute: Sulawesi) – Neuguinea liegt. Zu diesem Zweck wird eine Karte in kleinerem Maßstab beigegeben:
Zeitlich Die Erdgeschichte wird im Kambrium (vor 570 Millionen Jahren) mit dem Aufkommen mehrzelliger Tiere allmählich interessant; vor 65 Millionen Jahren entwickelten sich dann in immer rascherer Folge vierfüßige Wirbeltiere. — Würde man die Geschichte im immer gleichen Maßstab auf einer geraden Linie zeigen, würden sich die Einträge in den jüngsten Epochen so massieren, dass man sie nicht darstellen könnte. Das Diagramm ›zoomt‹ deshalb bei den jüngeren Epochen näher heran; man könnte auch von einer Zeit-Lupe sprechen:
|
||
|
neu eingestellt von PM im November 2019; Ergänzungen im März 2020; November 2023 |
||